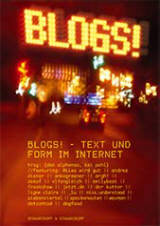Freitag, 21. April 2006
Die Skalpe meiner Feinde - Eyn Vorschlag
wie zu servieren sey der Spargel bey einer Lesung mit schwarzen Gedanken allhie auff dem Gottsacker:

Ich bin kein Christ. Trotzdem kenne ich diese Religion, zumindest was den Katholizismus angeht, besser als die meisten Christen. Ich habe ihre Kirchenväter gelesen, deren Bücher nach heutigem Verständnis klar verfassungsfeindlich sind. Ich kenne die Schriften, die mir aus Sicht der Kirche, im Prinzip bis heute, jedes Recht bishin zum Leben absprechen. Ich kenne die Debatten, ob eine Frau nun schon ein Tier oder noch eine Sache sei. Und wenn ich über die zersprungenen, abgeschliffenen Porphyrplatten laufe, die mit viel Geld an die Pfaffen und Betschwestern übergeben wurden, um das Andenken eines Menschen zu bewahren, weiss ich auch, wer der grösste Versicherungsbetrüger aller Zeiten ist.
Ich stehe dieser Schlechtigkeit mit der kühlen Betrachtung des Wissenschaftlers gegenüber. Und ich weiss, dass ich, der ich vor wenigen Jahrzehnten noch als ein Erzfeind gegolten hätte, heute Zeuge des letzten Kapitels ihres Niedergangs sein darf. 1900 verfluchte Jahre haben sie uns in Büchern gehasst, als Pöbel getreten und mit dem Segen der Oberen ermordet - wer das nicht weiss, kann den Luxus nicht empfinden, heute ungestraft, ohne mit Tritten und Steinen gejagt zu werden, die Reste des sterbenden Kolosses zu betrachten. Andere nehmen seine Stelle ein, die braunen Mordbanden, und die mittrabenden Schönbohms und Schäubles dieses Landes, in der einen Tasche den Scheck des Waffenhändlers und in der anderen das Handy, das hoffentlich irgendwann einmal die Bundeswehr dirigiert, im Inneren, gegen Missliebige; kein Wunder, dass sie sich in der Tradition des Ungetüms sehen.
Aber das ist vorbei. Ich kann es recht leidenschaftslos betrachten, in seinen letzten Zügen, im Wissen seiner Geschichte. Nur manchmal. Da überkommen mich diese Gedanken. Diese bitterbösen, fiesen Gedanken, von denen sie lange Zeit gedacht haben, unsereins könnte sie tatsächlich denken. Ja, wie wäre es denn. Heiliger Märtyrerspargel. Gedünstet, auf einem geschwungenen Teller mit Goldrand, ein klein wenig geriebenes Sauerkraut als Silber und ein Lauchblatt als Banderolen, schwimmend in goldener Bechamelsosse. Auf einer Rokokotischdecke. Wahlweise als Chrysostomos-Rippchen oder als Brustknochen der 1000 Jungfrauen zu interpretieren. Ein himmlischer Geschmack und ein höllisches Vergnügen, Satan, meines Elends Dich erbarme.
Morgen beginnt, um zum eigentlichen Thema zu kommen, die Spargelsaison. Die Zutaten bekommt man auch, wenn man am Sonntag nach Pfaffenhofen (sic!) auf den Flohmarkt fährt.

Ich bin kein Christ. Trotzdem kenne ich diese Religion, zumindest was den Katholizismus angeht, besser als die meisten Christen. Ich habe ihre Kirchenväter gelesen, deren Bücher nach heutigem Verständnis klar verfassungsfeindlich sind. Ich kenne die Schriften, die mir aus Sicht der Kirche, im Prinzip bis heute, jedes Recht bishin zum Leben absprechen. Ich kenne die Debatten, ob eine Frau nun schon ein Tier oder noch eine Sache sei. Und wenn ich über die zersprungenen, abgeschliffenen Porphyrplatten laufe, die mit viel Geld an die Pfaffen und Betschwestern übergeben wurden, um das Andenken eines Menschen zu bewahren, weiss ich auch, wer der grösste Versicherungsbetrüger aller Zeiten ist.
Ich stehe dieser Schlechtigkeit mit der kühlen Betrachtung des Wissenschaftlers gegenüber. Und ich weiss, dass ich, der ich vor wenigen Jahrzehnten noch als ein Erzfeind gegolten hätte, heute Zeuge des letzten Kapitels ihres Niedergangs sein darf. 1900 verfluchte Jahre haben sie uns in Büchern gehasst, als Pöbel getreten und mit dem Segen der Oberen ermordet - wer das nicht weiss, kann den Luxus nicht empfinden, heute ungestraft, ohne mit Tritten und Steinen gejagt zu werden, die Reste des sterbenden Kolosses zu betrachten. Andere nehmen seine Stelle ein, die braunen Mordbanden, und die mittrabenden Schönbohms und Schäubles dieses Landes, in der einen Tasche den Scheck des Waffenhändlers und in der anderen das Handy, das hoffentlich irgendwann einmal die Bundeswehr dirigiert, im Inneren, gegen Missliebige; kein Wunder, dass sie sich in der Tradition des Ungetüms sehen.
Aber das ist vorbei. Ich kann es recht leidenschaftslos betrachten, in seinen letzten Zügen, im Wissen seiner Geschichte. Nur manchmal. Da überkommen mich diese Gedanken. Diese bitterbösen, fiesen Gedanken, von denen sie lange Zeit gedacht haben, unsereins könnte sie tatsächlich denken. Ja, wie wäre es denn. Heiliger Märtyrerspargel. Gedünstet, auf einem geschwungenen Teller mit Goldrand, ein klein wenig geriebenes Sauerkraut als Silber und ein Lauchblatt als Banderolen, schwimmend in goldener Bechamelsosse. Auf einer Rokokotischdecke. Wahlweise als Chrysostomos-Rippchen oder als Brustknochen der 1000 Jungfrauen zu interpretieren. Ein himmlischer Geschmack und ein höllisches Vergnügen, Satan, meines Elends Dich erbarme.
Morgen beginnt, um zum eigentlichen Thema zu kommen, die Spargelsaison. Die Zutaten bekommt man auch, wenn man am Sonntag nach Pfaffenhofen (sic!) auf den Flohmarkt fährt.
donalphons, 13:11h
... link (16 Kommentare) ... comment
: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :
Donnerstag, 2. März 2006
Die Kronleuchter kommen!
Ende März bin ich wahrscheinlich in der Berliner Region - möglicherweise gerade rechtzeitig, um mir, wie angekündigt, aus dem untergehenden Club Goya einen venezianischen Kronleuchter zu holen. Die Chancen stehen seit gestern recht gut, denn der Aufsichtsrat der AG (höhö) hat neben dem Gründer Glückstein einen zweiten Vorstand installiert: Ein Rechtsanwalt kann sich jetzt mit dem Millionenloch und fehlenden Gehältern der Mitarbeiter rumschlagen.
Hoffentlich gibt es schnell eine Entscheidung, denn ich muss wissen, mit welchem Auto ich komme - die Barchetta dürfte für so einen Millionenprojektleuchter zu klein sein.
Hoffentlich gibt es schnell eine Entscheidung, denn ich muss wissen, mit welchem Auto ich komme - die Barchetta dürfte für so einen Millionenprojektleuchter zu klein sein.
donalphons, 03:26h
... link (18 Kommentare) ... comment
: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :
Donnerstag, 9. Februar 2006
Give Aways
Ich habe noch ein paar Kugelschreiber aus der grossen alten Zeit. Und einen Bierkrug aus Steingut, wo drauf steht: B2B in Upper Franconia means: Beer and Business. Und noch eine Menge anderen Plunder aus der New Economy, aus Plastik, witzig gedacht, heute nur noch schäbig anzuschauen. So wie die Zeit, an die zu erinnern einen schalen Geschmack hinterlässt. So viele Chancen, so viele Möglichkeiten wie niemals zuvor, und dann dieses Ergebnis. Ich darf mich eigentlich nicht beschweren, mein halbes Leben fusst noch in dieser Epoche, ich hatte als einer der wenigen Glück und bin auch irgendwie weiter vorne mit dabei, aber die anderen...
In einer Familienangelegenheit bin ich auf die Vorläufer der Give Aways gestossen. In einer Kiste auf dem Dachboden einer zur Disposition stehenden Immobilie, weit im Süden, nahe bei Salzburg, war eine Kiste, zugeschnürt und eingestaubt. Bis zum Rand gefüllt mit langen, flachen Holzkisten, die das Zeichen einer Bank trugen, die es heute nicht mehr gibt. Der Hausbesitzer war dort guter Kunde, und jedes Jahr zu Weihnachten, den in den Kisten liegenden Schreiben zufolge, schickte der Bankchef der kleinen Stadt an den Kunden eine dieser rötlich schimmernden, mit blauem Samt ausgeschlagenen Behältnisse, gefüllt mit einem Satz Silbermünzen aus der ganzen Welt.
Sie fanden offensichtlich keinen Liebhaber; der so Beschenkte hatte ohnehin wenig Sinn für Geldangelegenheiten und nutzte sein Vermögen vor allem, um den Niederungen des Daseins zu entfliehen; geliebt hat er Speere aus Kenia, Malereien aus Thailand, Silberschalen aus Vietnam, Pistolen aus Mauretanien und Gefässe aus China und Peru. Unbesehen, ungeöffnet gelangte das Silber in den Karton, für ihn nicht mehr wert als für mich ein Notizblock von Wedit - falls das noch jemand kennt.
Trotzdem, der Unterschied zu dem, was meine Epoche wegegeben hat, ist unbestreitbar. Es geht nicht um den banalen Wert, sondern einfach um den Gedanken der Nachhaltigkeit, der Dauerhaftigkeit dessen, was da vergeben wird. In der New Economy war es so viel, man konnte den Krempel tütenweise abschleppen, es war mit allen PR-Meetings und Agenturentwürfen und Analysen sicher nicht billiger als Silbermünzen, aber kein Mensch dachte damals weiter als 6 Monate, warum sollte man auch was hergeben, was länger Bestand hätte. Diese haltung, das Böse der aus dem Unterleib der Quartalsberichte, hat den Crash überlebt, weil es so alt ist wie die menschliche Dummheit. Und so glaubte ich fest an den weiteren Niedergang, bis mich mein Weg heute morgen zu Supercompany.de führte, dem viel geschmähten Businessableger von Boocompany. Da ist gleich links neben dem mittigen "Boo"-Pixel ein schwarzer Fleck mit einem T, und der wiederum führt zu Turell. Und die bieten wirklich schöne Blankobücher an.
Wenn also weiterhin ein Niedergang der Geschenke hin zu den Weggegebenen zu konstatieren ist, dann liegt das nicht am Angebot, sondern an der mangelnden Nachfrage der Business-Tanjas, der CEO-Rolfs und der PR-Anjas. Das ist Kapitalismus, Baby. Aber es gibt Hoffnung.
ich bich weder mit Supercompany noch mit Turell irgendwie geschäftlich - und bei Turell auch nicht privat - verbandelt. Ich mag nur schöne Notizbücher, das ist alles.
In einer Familienangelegenheit bin ich auf die Vorläufer der Give Aways gestossen. In einer Kiste auf dem Dachboden einer zur Disposition stehenden Immobilie, weit im Süden, nahe bei Salzburg, war eine Kiste, zugeschnürt und eingestaubt. Bis zum Rand gefüllt mit langen, flachen Holzkisten, die das Zeichen einer Bank trugen, die es heute nicht mehr gibt. Der Hausbesitzer war dort guter Kunde, und jedes Jahr zu Weihnachten, den in den Kisten liegenden Schreiben zufolge, schickte der Bankchef der kleinen Stadt an den Kunden eine dieser rötlich schimmernden, mit blauem Samt ausgeschlagenen Behältnisse, gefüllt mit einem Satz Silbermünzen aus der ganzen Welt.
Sie fanden offensichtlich keinen Liebhaber; der so Beschenkte hatte ohnehin wenig Sinn für Geldangelegenheiten und nutzte sein Vermögen vor allem, um den Niederungen des Daseins zu entfliehen; geliebt hat er Speere aus Kenia, Malereien aus Thailand, Silberschalen aus Vietnam, Pistolen aus Mauretanien und Gefässe aus China und Peru. Unbesehen, ungeöffnet gelangte das Silber in den Karton, für ihn nicht mehr wert als für mich ein Notizblock von Wedit - falls das noch jemand kennt.
Trotzdem, der Unterschied zu dem, was meine Epoche wegegeben hat, ist unbestreitbar. Es geht nicht um den banalen Wert, sondern einfach um den Gedanken der Nachhaltigkeit, der Dauerhaftigkeit dessen, was da vergeben wird. In der New Economy war es so viel, man konnte den Krempel tütenweise abschleppen, es war mit allen PR-Meetings und Agenturentwürfen und Analysen sicher nicht billiger als Silbermünzen, aber kein Mensch dachte damals weiter als 6 Monate, warum sollte man auch was hergeben, was länger Bestand hätte. Diese haltung, das Böse der aus dem Unterleib der Quartalsberichte, hat den Crash überlebt, weil es so alt ist wie die menschliche Dummheit. Und so glaubte ich fest an den weiteren Niedergang, bis mich mein Weg heute morgen zu Supercompany.de führte, dem viel geschmähten Businessableger von Boocompany. Da ist gleich links neben dem mittigen "Boo"-Pixel ein schwarzer Fleck mit einem T, und der wiederum führt zu Turell. Und die bieten wirklich schöne Blankobücher an.
Wenn also weiterhin ein Niedergang der Geschenke hin zu den Weggegebenen zu konstatieren ist, dann liegt das nicht am Angebot, sondern an der mangelnden Nachfrage der Business-Tanjas, der CEO-Rolfs und der PR-Anjas. Das ist Kapitalismus, Baby. Aber es gibt Hoffnung.
ich bich weder mit Supercompany noch mit Turell irgendwie geschäftlich - und bei Turell auch nicht privat - verbandelt. Ich mag nur schöne Notizbücher, das ist alles.
donalphons, 12:12h
... link (12 Kommentare) ... comment
: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :
Mittwoch, 23. März 2005
Ein Kinderlied zwo drei vier
Vom zwei Bloggern was gehaun
Wi di wi di wir und die NZ macht Freude,
Wir dengeln uns das Google,
Wi di wi di wie es uns gefällt.
Hey Stefan Keuchel
Tra la li, tra la la,
Tra la hop sa sa,
Hey, Stefan Keuchel
Du macht besser was uns gefällt.
Drei mal PRler scheuchen,
Wi di di di wer will's von uns lernen?
(Abteilung infantil-innovative Linkschleuder) Wir warten auf die Entfernung der Nationalzeitung, Keuchel. Und eine Entschuldigung für die "verschiedenen Blickwinkel", die hier kein Mensch mehr braucht. Auch nicht Google.
Wi di wi di wir und die NZ macht Freude,
Wir dengeln uns das Google,
Wi di wi di wie es uns gefällt.
Hey Stefan Keuchel
Tra la li, tra la la,
Tra la hop sa sa,
Hey, Stefan Keuchel
Du macht besser was uns gefällt.
Drei mal PRler scheuchen,
Wi di di di wer will's von uns lernen?
(Abteilung infantil-innovative Linkschleuder) Wir warten auf die Entfernung der Nationalzeitung, Keuchel. Und eine Entschuldigung für die "verschiedenen Blickwinkel", die hier kein Mensch mehr braucht. Auch nicht Google.
donalphons, 14:26h
... link (25 Kommentare) ... comment
: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :
Freitag, 11. März 2005
Ihr auf der CeBit: Sie wollen Euren Skalp.
Gestern rutschten ein paar Tonnen Schnee vom Dach des Stadtpalastes runter und drückten die Glastür zu Terasse ein. Der Dachdecker, der die Tür eingebaut hatte, schickte einen Mann, der hier "A Mo" genannt wird. Der Mo ist ein Mann, nicht mehr, nicht weniger, er kommt, schaut das Problem an und behebt es mit der linken Hand. In der rechten hält er die Flasche Bier. Ausserdem sagt der Mo, dem Dachdecker täte das Leid, er würde das gern persönlich sagen, ob ich nicht vorbeikommen will, bei seinem Stand auf der Ausstellung am Rande der Altstadt.
Da kann man nicht Nein sagen, wenn man sich die Achtung der Leute nicht verscherzen will. Also lasse ich mich vom Mo auf die Ausstellung fahren, deren Logo, Website und Plakate Massenvernichtungswaffen für verzärtelte Designer in Metropolen wären: Bunt, schlicht, grob. An den Werbemitteln vorbei fliesst ein Strom von Menschen aller Altersstufen, hin zum Messegelände, wo die Firmen der Region erklären, was sie so tun. Ich gehe zum Dachdecker, wir reden eine Weile über die Qualität von Dachstühlen des 16. Jahrhunderts und Donaueiche, die, gut gepflegt, locker ein, zwei Jahrtausende hält. Ein Photo von meinem Dachstuhl, Baujahr 1600, ziert die braune Stellwand an seinem Stand.

Ich verabschiede mich vom Dachdecker und vom Mo, und gehe noch etwas umher. Maler, Gerüstbauer, Installateure und Restaurateure kenne ich auch, wir unterhalten uns über das Geschäft. Alle sind echte Mannsbilder, nicht dünn, robust, kompakt, und wenn man die Invasion der McKinseys in ein Unternehmen aufhalten wollte, würde einer davon, mit einer ordentlichen Dachlatte oder einem 2,5 zölligen Kupferrohr in der Hand ausreichen, um die Jahresleistung der McK-HR ungespitzt in den Boden zu hauen, wie man hier bei uns sagt. Selbst die normalen Arbeiter fahren dicke Geländewägen und sehen zufrieden aus. Es geht ihnen gut, die Region brummt. Man achtet sich, es ist genug für alle da, der Chef sagt zu allen Meister, und die Arbeiter nennen ihn Chef.
Der Gerüstbauer hat kräftig expandiert und zeigt den staunenden Kindern seine neueste Hebebühne. Später dürfen sie in den Lastwagen probesitzen, und Süssigkeiten bei dem Weltmarktführern holen. Davon gibt es hier einige, aber alle kommen hier her, weil es ihre Heimat ist, und, so sagt mir ein Geschäftsführer, es wichtig ist, dass auch die Familien mal sehen, wo Vater und Mutter arbeiten. Klar, das grosse Geld verdienen sie in Osteuropa, am Golf und Ostasien, aber ihre Kunden wollen die Qualität, die in einem kleinen Dorf im Altmühltal entsteht, und nichts anderes.
Auf dem Weg nach draussen komme ich noch bei einem Konkurrenten der Firma vorbei, bei der mein Vater Teilhaber ist. Was nicht heisst, dass man nicht befreundet ist. Als es ihm mal nicht gut ging, hat mein Vater ein paar Aufträge an ihn abgetreten. Beide Firmen haben in den letzten 30 Jahren niemanden entlassen. Das ist absolut unvorstellbar, denn wer dort arbeitet, gehört diese 37,5 Stunden mit seiner ganzen Kraft und Überzeugung zur Firma, man braucht sein Wissen, seine Erfahrung, seinen Witz und seine Art. Geschweisst wird dieses Bündniss auf den Volksfesten und in den Werkhallen, und alle wissen, dass die Chefs früher selber nur zu zweit waren und alles gemacht haben, von der Abrechnung bis zum Müll. Seit 1946 schreiben beide Firmen schwarze Zahlen. Als der Gründer mit 84 Jahren im Büro tot umfiel, kamen alle aus beiden Firmen auf die Beerdigung. Sein Sohn hat lediglich ein neues Telefon einbauen lassen. Die eMails werden von der Sekretärin formatiert, ausgedruckt und vorgelegt. So ist das hier, im reichen Herz des Landes.
He, Ihr kleinen Pinscher auf der CeBit, Ihr stinkenden Wichtigtuer, Ihr Zukunftswichser, Ihr verkommene Bande von Verlierern, Ihr Ausgeburten kranker Beraterhirne, all Ihr Business Prozess Value Chain Data Mining Micro Marketing Optimizing Tools Provider und Success Revenue Outsourcing Enabling Creators: Wenn Ihr von KMU sprecht, in Euren idiotischen Powerpoints, dann macht Euch klar: Es gibt diese KMUs nicht, diese Idioten, die Euch Geld für Euer Gesülze geben. Es gibt nur Leute, die was vom Geschäft verstehen, und die wissen, dass die Anschaffung Eurer Lügenbeamer nur rausgeschmissenes Geld ist, das sie Euch nicht bezahlen werden. Sie werden Euch vielleicht anhören und Angebote vortragen lassen. Sie werden Euch in den Staub verhandeln, weil Ihr mit Eurer Art für sie Dreck seid, und diese Behandlung das einzige ist, um den Respekt ihrer Meister zu behalten. Sie werden Euch Deadlines und Milestones reinbetonieren, dass ihr nur noch nach Luft schnappt, und wenn Eure Arbeit nicht auf den letzten Punkt so ist, wie es im Vetrag steht, werdet Ihr keinen Cent sehen. Ihr werdet der unterste, billigste Diener sein, und wenn Ihr dabei drauf geht, ist es denen egal, weil Ihr kein Teil des Systems seid. Ihr seid nicht auf dieser Messe. Ihr könnt nicht schafkopfen, ihr seid irrelevant und nur dann akzeptiert, wenn Ihr mehr gebt, als Ihr bekommt. Keinen Konkurrenten, keinen Arbeiter, keinen Hund würde man so behandeln, wie man Euch behandelt.
Sie wollen nicht Eure Prospekte und Medienberichte in Sudelblättern, die hier keiner kennt, sie wollen Euren Skalp. Und Ihr mickrigen Dienstleister werdet diesen Skalp abliefern, denn Ihr braucht jeden Auftrag. Ihr habt keine Wahl. Danach werden sie Eure Knochen abnagen und das Mark aus dem Bein saugen. Und ihre Männer werden daneben stehen, das Bier in der Hand, und es gut finden.
Da kann man nicht Nein sagen, wenn man sich die Achtung der Leute nicht verscherzen will. Also lasse ich mich vom Mo auf die Ausstellung fahren, deren Logo, Website und Plakate Massenvernichtungswaffen für verzärtelte Designer in Metropolen wären: Bunt, schlicht, grob. An den Werbemitteln vorbei fliesst ein Strom von Menschen aller Altersstufen, hin zum Messegelände, wo die Firmen der Region erklären, was sie so tun. Ich gehe zum Dachdecker, wir reden eine Weile über die Qualität von Dachstühlen des 16. Jahrhunderts und Donaueiche, die, gut gepflegt, locker ein, zwei Jahrtausende hält. Ein Photo von meinem Dachstuhl, Baujahr 1600, ziert die braune Stellwand an seinem Stand.

Ich verabschiede mich vom Dachdecker und vom Mo, und gehe noch etwas umher. Maler, Gerüstbauer, Installateure und Restaurateure kenne ich auch, wir unterhalten uns über das Geschäft. Alle sind echte Mannsbilder, nicht dünn, robust, kompakt, und wenn man die Invasion der McKinseys in ein Unternehmen aufhalten wollte, würde einer davon, mit einer ordentlichen Dachlatte oder einem 2,5 zölligen Kupferrohr in der Hand ausreichen, um die Jahresleistung der McK-HR ungespitzt in den Boden zu hauen, wie man hier bei uns sagt. Selbst die normalen Arbeiter fahren dicke Geländewägen und sehen zufrieden aus. Es geht ihnen gut, die Region brummt. Man achtet sich, es ist genug für alle da, der Chef sagt zu allen Meister, und die Arbeiter nennen ihn Chef.
Der Gerüstbauer hat kräftig expandiert und zeigt den staunenden Kindern seine neueste Hebebühne. Später dürfen sie in den Lastwagen probesitzen, und Süssigkeiten bei dem Weltmarktführern holen. Davon gibt es hier einige, aber alle kommen hier her, weil es ihre Heimat ist, und, so sagt mir ein Geschäftsführer, es wichtig ist, dass auch die Familien mal sehen, wo Vater und Mutter arbeiten. Klar, das grosse Geld verdienen sie in Osteuropa, am Golf und Ostasien, aber ihre Kunden wollen die Qualität, die in einem kleinen Dorf im Altmühltal entsteht, und nichts anderes.
Auf dem Weg nach draussen komme ich noch bei einem Konkurrenten der Firma vorbei, bei der mein Vater Teilhaber ist. Was nicht heisst, dass man nicht befreundet ist. Als es ihm mal nicht gut ging, hat mein Vater ein paar Aufträge an ihn abgetreten. Beide Firmen haben in den letzten 30 Jahren niemanden entlassen. Das ist absolut unvorstellbar, denn wer dort arbeitet, gehört diese 37,5 Stunden mit seiner ganzen Kraft und Überzeugung zur Firma, man braucht sein Wissen, seine Erfahrung, seinen Witz und seine Art. Geschweisst wird dieses Bündniss auf den Volksfesten und in den Werkhallen, und alle wissen, dass die Chefs früher selber nur zu zweit waren und alles gemacht haben, von der Abrechnung bis zum Müll. Seit 1946 schreiben beide Firmen schwarze Zahlen. Als der Gründer mit 84 Jahren im Büro tot umfiel, kamen alle aus beiden Firmen auf die Beerdigung. Sein Sohn hat lediglich ein neues Telefon einbauen lassen. Die eMails werden von der Sekretärin formatiert, ausgedruckt und vorgelegt. So ist das hier, im reichen Herz des Landes.
He, Ihr kleinen Pinscher auf der CeBit, Ihr stinkenden Wichtigtuer, Ihr Zukunftswichser, Ihr verkommene Bande von Verlierern, Ihr Ausgeburten kranker Beraterhirne, all Ihr Business Prozess Value Chain Data Mining Micro Marketing Optimizing Tools Provider und Success Revenue Outsourcing Enabling Creators: Wenn Ihr von KMU sprecht, in Euren idiotischen Powerpoints, dann macht Euch klar: Es gibt diese KMUs nicht, diese Idioten, die Euch Geld für Euer Gesülze geben. Es gibt nur Leute, die was vom Geschäft verstehen, und die wissen, dass die Anschaffung Eurer Lügenbeamer nur rausgeschmissenes Geld ist, das sie Euch nicht bezahlen werden. Sie werden Euch vielleicht anhören und Angebote vortragen lassen. Sie werden Euch in den Staub verhandeln, weil Ihr mit Eurer Art für sie Dreck seid, und diese Behandlung das einzige ist, um den Respekt ihrer Meister zu behalten. Sie werden Euch Deadlines und Milestones reinbetonieren, dass ihr nur noch nach Luft schnappt, und wenn Eure Arbeit nicht auf den letzten Punkt so ist, wie es im Vetrag steht, werdet Ihr keinen Cent sehen. Ihr werdet der unterste, billigste Diener sein, und wenn Ihr dabei drauf geht, ist es denen egal, weil Ihr kein Teil des Systems seid. Ihr seid nicht auf dieser Messe. Ihr könnt nicht schafkopfen, ihr seid irrelevant und nur dann akzeptiert, wenn Ihr mehr gebt, als Ihr bekommt. Keinen Konkurrenten, keinen Arbeiter, keinen Hund würde man so behandeln, wie man Euch behandelt.
Sie wollen nicht Eure Prospekte und Medienberichte in Sudelblättern, die hier keiner kennt, sie wollen Euren Skalp. Und Ihr mickrigen Dienstleister werdet diesen Skalp abliefern, denn Ihr braucht jeden Auftrag. Ihr habt keine Wahl. Danach werden sie Eure Knochen abnagen und das Mark aus dem Bein saugen. Und ihre Männer werden daneben stehen, das Bier in der Hand, und es gut finden.
donalphons, 05:05h
... link (46 Kommentare) ... comment
: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :
Samstag, 19. Februar 2005
Die Skalpe meiner Feinde - 15 Jahre treue Gefolgschaft.
Leonard Monheim. Ist im Spiegel der mittelgrossen Silberschale eingraviert, die ich heute gekauft habe. Irgendwann in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts also hat besagter Leonard Monheim diese Schale erworben, die nicht billig, aber auch nicht allzu teuer gewesen sein dürfte, er hat die Schrift anbringen lassen und sie der Person geschenkt, die 15 Jahre in seiner Gefolgschaft war und sich dabei offensichtlich gut verhalten hat.

15 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Wenn jemand 15 Jahre gut für eine Sache, eine Person arbeitet, sollte auch so etwas wie persönliche Nähe entstehen. Und es sollte vielleicht als etwas anderes wahrgenommen werden, als treue Gefolgschaft. Die vorraussetzt, dass der andere nicht nur der Führer ist, sondern auch die Folgen des Standesdenken als Wert definiert, sonst wäre es nicht in Silber verewigt. Selbst im Boden des Fressnapfes eines Hundes wäre so eine Inschrift nach 15 Jahren etwas seltsam unpersönlich. Der Wert ist Treue und Folgsamkeit, kein eigenes Denken, keine konstruktive Kritik, kein freier Wille, kein Ratschlag. Maul halten, mitmachen, keine blöden Fragen stellen, nach 15 Jahren gibt es dafür eine Silberschale, in der steht, dass man dem System ordentlich angepasst war. Toll.
15 Jahre, und dann vielleicht noch lange Zeit weiteres Vegetieren im Dienst der Sache. Die Erben finden das nach dem Tod nicht besonders wichtig, vielleicht sogar peinlich, und überlassen die Schale lieber dem Wohnungsentrümpler. Der sieht das auch als Problemfall an und ist schnell bereit, mit dem Preis runterzugehen. Am Ende sind wir knapp über dem Materialwert, für die feine Arbeit und die dumme Inschrift gibt es gerade mal 10 Euro über dem, was es nach dem Einschmelzen wert wäre. Das also ist der aktuelle Marktwert von 15 Jahren treuer Gefolgschaft.
Leonard Monheim und der Beschenkte wären sicher nicht froh, wenn sie wüssten, dass die Schale mir jetzt als Brotkorb dient, und die beizeiten, beim Frühstück danach, unachtsam und ohne jede Beachtung der Inschrift leergefressen werden wird, von einer jungen Frau, vielleicht fleischige Elitesse, vielleicht dünne Buchhändlerin, die in diesem Moment alles andere als treu ist, und ganz sicher nicht dem folgt, was Gesellschaft, ihr Freund und die Peer Group von ihr erwartet. 15 gottverdammte Jahre sind nichts gegen so eine Nacht davor, und dem Frühstück mit den Spolien der versunkenen Spiessergrossreiche danach.
Alle Skalpe

15 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Wenn jemand 15 Jahre gut für eine Sache, eine Person arbeitet, sollte auch so etwas wie persönliche Nähe entstehen. Und es sollte vielleicht als etwas anderes wahrgenommen werden, als treue Gefolgschaft. Die vorraussetzt, dass der andere nicht nur der Führer ist, sondern auch die Folgen des Standesdenken als Wert definiert, sonst wäre es nicht in Silber verewigt. Selbst im Boden des Fressnapfes eines Hundes wäre so eine Inschrift nach 15 Jahren etwas seltsam unpersönlich. Der Wert ist Treue und Folgsamkeit, kein eigenes Denken, keine konstruktive Kritik, kein freier Wille, kein Ratschlag. Maul halten, mitmachen, keine blöden Fragen stellen, nach 15 Jahren gibt es dafür eine Silberschale, in der steht, dass man dem System ordentlich angepasst war. Toll.
15 Jahre, und dann vielleicht noch lange Zeit weiteres Vegetieren im Dienst der Sache. Die Erben finden das nach dem Tod nicht besonders wichtig, vielleicht sogar peinlich, und überlassen die Schale lieber dem Wohnungsentrümpler. Der sieht das auch als Problemfall an und ist schnell bereit, mit dem Preis runterzugehen. Am Ende sind wir knapp über dem Materialwert, für die feine Arbeit und die dumme Inschrift gibt es gerade mal 10 Euro über dem, was es nach dem Einschmelzen wert wäre. Das also ist der aktuelle Marktwert von 15 Jahren treuer Gefolgschaft.
Leonard Monheim und der Beschenkte wären sicher nicht froh, wenn sie wüssten, dass die Schale mir jetzt als Brotkorb dient, und die beizeiten, beim Frühstück danach, unachtsam und ohne jede Beachtung der Inschrift leergefressen werden wird, von einer jungen Frau, vielleicht fleischige Elitesse, vielleicht dünne Buchhändlerin, die in diesem Moment alles andere als treu ist, und ganz sicher nicht dem folgt, was Gesellschaft, ihr Freund und die Peer Group von ihr erwartet. 15 gottverdammte Jahre sind nichts gegen so eine Nacht davor, und dem Frühstück mit den Spolien der versunkenen Spiessergrossreiche danach.
Alle Skalpe
donalphons, 17:06h
... link (16 Kommentare) ... comment
: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :
Dienstag, 28. September 2004
Noch ein Skalp von meinen Feinden.
Der Wedding ist nicht so arm, wie es oft behauptet wird. Vielmehr fügt er sich harmonisch in den Gesamtslum ein, der diesen Vorort von Marzahn b.d. Spree ausmacht. Es gab hier wohl auch eine Oberschicht, sonst hätte der türkische Juwelier in der Badstrasse wohl nicht aus einem Nachlass das silberne Vorlegebesteck bekommen, dessen Kauf ich mir seit drei Monaten überlege. Ich hatte es mir schon angeschaut und für zu teuer befunden, und gestern war es dann aus dem Schaufenster verschwunden. Wie so oft, denkt man dann, man hätte doch, und warum war man nur so dumm und hat nicht. Nicht ganz ohne Hoffnung betrat ich den Laden, und der Besitzer erkannte mich sofort wieder. Der junge Herr mit dem Silberbesteck, jetzt doch, Moment, er hole es nur schnell von hinten, da hat er es nämlich hingetan.
Während er kurz verschwand, warf ich einen Blick auf die gebrauchten Armbanduhren in der Glasvitrine. Unter all den billigen Seikos, Dugenas und etwas besseren Tissots lag auch eine klassische, dezente Rolex Oyster Perpetual Datejust, eine Oyster wie die, damals...

Damals, in der kleinen Stadt, aus der ich stamme, gab es keine klassenlose Gesellschaft, ganz im Gegenteil. Die 10% Oberschicht, hauptsächlich Vertreter der alten lokalen Oligarchie und der vom Boom angezogenen Unternehmer, Ärzte und Manager blieb unter sich. Diese Klasse besetzte bestimmte Viertel, erträumte sich die üblichen Karrieren ihrer Kinder und traf sich zu festgesetzten Ritualen wie dem Konzertverein mit seinem Churochersterrepertoire oder den Galerien für moderner, zahnarztkompatibler Kunst, in Ermangelung eines literarischen oder sonst wie ausgeprägten kulturellen Lebens. Dafür konnte man auch schnell nach München, wenn man sich denn so anstrengen wollte. Meistens blieben sie zu Hause, erfreuten sich an Rundbögen, Kachelöfen und dem Blubbern der V8-Motoren, und bestritten, reich zu sein, weil ihnen dieser Begriff doch sehr fern lag, auch wenn sie ein paar Mietshäuser geerbt hatten.
Wenn ihre Kinder bis zum Abitur nicht in der Psychiatrie gelandet waren, sich unter Drogen vom Hochhaus gestürzt oder ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Motorrad gegen die Wand pilotiert hatten, gab es immer im Mai, nach den Prüfungen zur Hochschulreife ein weiteres Ritual in dieser Gesellschaft. Die Eltern fuhren in die Stadt zum ersten Juwelier am Platz, Dürrkopp, der schon seit Generationen diese Schicht in dieser Stadt beliefert. Dort kauften sie dann für ihre Kinder Uhren. Und fast immer war es die Rolex Oyster Perpetual Datejust in Stahl für die Jungen, und mit Goldlunette und Kettengliedern für die Mädchen, auf die die Wahl der Eltern fiel. Das sind Uhren, die ein gewisses Prestige haben, aber nicht so brutal und peinlich sind wie der Brocken Submariner oder die Breitling Chronographen, die sich meine Freunde damals eigentlich gewünscht haben - und wegen der grazilen Oyster nicht bekamen.
Bei mir lag der Fall anders, ich floh sofort nach der Prüfung vor den Idioten meines Jahrgangs in die USA, und hatte einen Blankoscheck für eine sehnlich gewünschte Gruen Curvex dabei; eine legendäre Armbanduhr aus den dreissiger Jahren, die ich dann auch in Visalia/California fand. Dass ich der Rolex entging, lag aber auch an der Tatsache, dass Gruen und Rolex damals die gleiche Firma waren, was meinem Vater die Entscheidung für den Blankoscheck erleichterte.
Zurück in der Heimat, hatte ich dann eine Beziehung mit einem schnippischen Mädchen aus besserem Hause, das ebenfalls diese typische Apothekerstochter-Rolex trug, auch im Bett, und erst seitdem war diese Uhr für mich der Inbegriff dieser Generation, die das Pech hatte, nicht verloren zu gehen, sondern in der Heimat in halbwegs gesicherten Verhältnissen und vom Geld der Vorfahren vor sich hinzudämmern. Ich sah sie wieder an den Handgelenken der Startup-Söhnchen, die wenige Jahre später nichts mehr auf Sicherheit gaben und gründen wollten, die glaubten, sie könnten auf den Erfolg ihrer Eltern noch einen Success draufpacken. Bei ihnen wurde die Oyster das Garantiesiegel der Klasse, auf die VCs insgeheim mehr Wert legten als auf ein ordentliches Geschäftsmodell. Und ich sah sie an den schnell aufgestiegenen Praktis, die als Senior Irgendwas Manager nach drei Monaten sich auch so ein Teil beschafften, um mitzuhalten, wenn der Boss sich seine neue Patek aus der Schweiz mitbrachte.
Und ich sah sie hier, im Wedding, in einer nicht allzu sauberen Vitrine unter so viel Ramsch.
Die Rolex, fragte mich der Besitzer des Ladens, der den alten Lederkoffer mit dem Besteck gebracht hatte.
Ist die echt, fragte ich, und wusste sofort, dass es ein Fehler war, das zu fragen.
Natürlich, sagte er, nahm sie aus der Vitrine. Jeder fragt, ob sie echt ist, schauen Sie nur; er drehte sie um, hob den lose aufgelegten Deckel und zeigte mir das fraglos originale, gravierte Werk. Wenn Sie wollen, mache ich Ihnen einen Sonderpreis.
Nein danke, sagte ich, ich habe sie nur gesehen...
Wirklich billig, eine Gelegenheit, sagte er. Und die kommt aus gutem Besitz, der Vorbesitzer hat Probleme mit seiner Firma und der Steuer und brauchte schnell Geld, aber hier ist es schwer zu verkaufen, weil die Leute hier, die wollen nur so dicke Submariner, aber Sie verstehen was davon, nicht wahr? Ich mache Ihnen einen Vorschlag, mit dem Besteck für - und er nannte einen wirklich günstigen, sehr günstigen Preis, drückte den hinteren Deckel drauf und reichte sie mir. Für Xxxx von deinen Eltern zum Abitur 1987, ist hinten in verschnörkelten Buchstaben eingraviert.
Original, wirklich, sagte der Händler, probieren Sie. Ich legte sie an, und sie passte. OK, sagte ich, ich nehme sie. Sie passt zu meinen anderen Skalpen.
Während er kurz verschwand, warf ich einen Blick auf die gebrauchten Armbanduhren in der Glasvitrine. Unter all den billigen Seikos, Dugenas und etwas besseren Tissots lag auch eine klassische, dezente Rolex Oyster Perpetual Datejust, eine Oyster wie die, damals...

Damals, in der kleinen Stadt, aus der ich stamme, gab es keine klassenlose Gesellschaft, ganz im Gegenteil. Die 10% Oberschicht, hauptsächlich Vertreter der alten lokalen Oligarchie und der vom Boom angezogenen Unternehmer, Ärzte und Manager blieb unter sich. Diese Klasse besetzte bestimmte Viertel, erträumte sich die üblichen Karrieren ihrer Kinder und traf sich zu festgesetzten Ritualen wie dem Konzertverein mit seinem Churochersterrepertoire oder den Galerien für moderner, zahnarztkompatibler Kunst, in Ermangelung eines literarischen oder sonst wie ausgeprägten kulturellen Lebens. Dafür konnte man auch schnell nach München, wenn man sich denn so anstrengen wollte. Meistens blieben sie zu Hause, erfreuten sich an Rundbögen, Kachelöfen und dem Blubbern der V8-Motoren, und bestritten, reich zu sein, weil ihnen dieser Begriff doch sehr fern lag, auch wenn sie ein paar Mietshäuser geerbt hatten.
Wenn ihre Kinder bis zum Abitur nicht in der Psychiatrie gelandet waren, sich unter Drogen vom Hochhaus gestürzt oder ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Motorrad gegen die Wand pilotiert hatten, gab es immer im Mai, nach den Prüfungen zur Hochschulreife ein weiteres Ritual in dieser Gesellschaft. Die Eltern fuhren in die Stadt zum ersten Juwelier am Platz, Dürrkopp, der schon seit Generationen diese Schicht in dieser Stadt beliefert. Dort kauften sie dann für ihre Kinder Uhren. Und fast immer war es die Rolex Oyster Perpetual Datejust in Stahl für die Jungen, und mit Goldlunette und Kettengliedern für die Mädchen, auf die die Wahl der Eltern fiel. Das sind Uhren, die ein gewisses Prestige haben, aber nicht so brutal und peinlich sind wie der Brocken Submariner oder die Breitling Chronographen, die sich meine Freunde damals eigentlich gewünscht haben - und wegen der grazilen Oyster nicht bekamen.
Bei mir lag der Fall anders, ich floh sofort nach der Prüfung vor den Idioten meines Jahrgangs in die USA, und hatte einen Blankoscheck für eine sehnlich gewünschte Gruen Curvex dabei; eine legendäre Armbanduhr aus den dreissiger Jahren, die ich dann auch in Visalia/California fand. Dass ich der Rolex entging, lag aber auch an der Tatsache, dass Gruen und Rolex damals die gleiche Firma waren, was meinem Vater die Entscheidung für den Blankoscheck erleichterte.
Zurück in der Heimat, hatte ich dann eine Beziehung mit einem schnippischen Mädchen aus besserem Hause, das ebenfalls diese typische Apothekerstochter-Rolex trug, auch im Bett, und erst seitdem war diese Uhr für mich der Inbegriff dieser Generation, die das Pech hatte, nicht verloren zu gehen, sondern in der Heimat in halbwegs gesicherten Verhältnissen und vom Geld der Vorfahren vor sich hinzudämmern. Ich sah sie wieder an den Handgelenken der Startup-Söhnchen, die wenige Jahre später nichts mehr auf Sicherheit gaben und gründen wollten, die glaubten, sie könnten auf den Erfolg ihrer Eltern noch einen Success draufpacken. Bei ihnen wurde die Oyster das Garantiesiegel der Klasse, auf die VCs insgeheim mehr Wert legten als auf ein ordentliches Geschäftsmodell. Und ich sah sie an den schnell aufgestiegenen Praktis, die als Senior Irgendwas Manager nach drei Monaten sich auch so ein Teil beschafften, um mitzuhalten, wenn der Boss sich seine neue Patek aus der Schweiz mitbrachte.
Und ich sah sie hier, im Wedding, in einer nicht allzu sauberen Vitrine unter so viel Ramsch.
Die Rolex, fragte mich der Besitzer des Ladens, der den alten Lederkoffer mit dem Besteck gebracht hatte.
Ist die echt, fragte ich, und wusste sofort, dass es ein Fehler war, das zu fragen.
Natürlich, sagte er, nahm sie aus der Vitrine. Jeder fragt, ob sie echt ist, schauen Sie nur; er drehte sie um, hob den lose aufgelegten Deckel und zeigte mir das fraglos originale, gravierte Werk. Wenn Sie wollen, mache ich Ihnen einen Sonderpreis.
Nein danke, sagte ich, ich habe sie nur gesehen...
Wirklich billig, eine Gelegenheit, sagte er. Und die kommt aus gutem Besitz, der Vorbesitzer hat Probleme mit seiner Firma und der Steuer und brauchte schnell Geld, aber hier ist es schwer zu verkaufen, weil die Leute hier, die wollen nur so dicke Submariner, aber Sie verstehen was davon, nicht wahr? Ich mache Ihnen einen Vorschlag, mit dem Besteck für - und er nannte einen wirklich günstigen, sehr günstigen Preis, drückte den hinteren Deckel drauf und reichte sie mir. Für Xxxx von deinen Eltern zum Abitur 1987, ist hinten in verschnörkelten Buchstaben eingraviert.
Original, wirklich, sagte der Händler, probieren Sie. Ich legte sie an, und sie passte. OK, sagte ich, ich nehme sie. Sie passt zu meinen anderen Skalpen.
donalphons, 14:16h
... link (37 Kommentare) ... comment
: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :
Samstag, 14. August 2004
Skalpe meiner Feinde Teil 3 - Wilkhahn FS 212/5
Wilkhahn; wenn der Bund der Steuerzahler (der ironischerweise oft Firmen vertritt, die keine Steuern zahlen) diesen Namen in den Beschaffungslisten des Bundes liest, gibt es Ärger. Während Eames der Cadillac der Bürostühle ist, ist die FS-Linie von Wilkhahn die Mercedes E-Klasse. Wilkhahn ist etwas, was sich ein Volksvertreter eigentlich nicht leisten darf, denn die sind wirklich teuer, sagen die Steuerzahler.
Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Wilkhahn ist nicht billig. Dafür ist es hervorragende Qualität, hält ewig und entspricht deshalb heute mehr dem Bauhausideal als all die billigen Marcel-Breuer-Kopien, die nach 2 Jahren reif für den Müll sind. Langfristig gesehen, ist Wilkhahn auch wegen der ergonomischen Form günstig - rechnet man staatlicherseits die dadurch vermiedenen Rückenprobleme rein, ist die Total Cost of Ownership geringer als bei dem billigen Ramsch, den so ein Steuerzahlerbunds-Apparatschik einem Politiker wünschen würde.
Gerade auf dem Höhepunkt der New Economy 1999/2000 wurde Wilkhahn gekauft, als gäb´s kein morgen morgen mehr. Weniger von Startups, die eher den dynamischen Eames den Vorzug gaben, als vielmehr von Banken, Finanzdienstleistern, VCs und Investmentberatern. Die 1100 Euro (ohne Mehrwertsteuer), die so ein Einstiegs-Freischwinger kostet, zahlten die damals aus der Portokasse

Vor ein paar Wochen bin ich mit einer Person zusammengeraten, die sich ganz in IBM-blau im Internet als jpg wiederfindet. Sehr selbstüberzeugt, der Herr; meinte, er habe schon den Spiegel und den Stern in die Knie gezwungen. Für ordentliches Briefpapier hat es trotzdem nicht gereicht; sein Schreiben kam als Ausdruck vom Tintenstrahldrucker mit erheblichen Farbschwächen. Erinnerte mehr an die "Verkaufen Sie mir Ihr Auto"-Fitzel, die sie einem hier in Berlin a.d. Spree in die Aussenspiegel stecken.
Man tut solchen Leuten dummerweise dann die Ehre, sie zu googlen. In diesem Fall kam raus, dass unter seiner Geschäftskunden auch Personen zu finden sind, die im Skandal rund um die Berliner Bankgesellschaft öfters in den Medien waren, als es ihnen lieb sein konnte. Ihre kritisierten Handlungen betrieben sie ebenfalls von der Wilkhahn FS-Linie herab, denn die BB schwor auf Qualität bei den Möbeln mehr, als bei den Investments.
Mittlerweile jedoch sind die betreffenden Personen von ihren Posten radikal entfernt worden, und das ist auch gut so. Aber weil sich bekanntlich bei notorischen Verschwendern nie was ändert, werden jetzt auch gleich noch ihre Sitzgelegenheiten mitsamt Eigentumsaufkleber an der Unterseite entsorgt. Wahrscheinlich hat man die Stühle weggeworfen, denn anders ist es nicht zu verstehen, wenn sie jetzt, perfekt gepflegt und fast nicht benützt, für 30 Euro das Stück beim Händler des Vetrauens verramscht werden - der übrigens darauf schwört, dass diese Stühle 100 Euro im Laden kosten. Nach dem Aufeinanderprall zweier orientalischer Charaktere sind es dann übrigens nur noch 20 Euro pro Stuhl, wie der, auf dem ich jetzt gerade sitze, und das typische Wilkhahn-Feeling habe, wie damals, 2000 bei einem VC hoch über der Leopoldstrasse...
Und mir überlege, auf was für einem billigen Ikea-Gerümpel gerade sein Vorbesitzer sitzen mag. Denn wer bei der BB rausfliegt und am Skandal beteiligt war, findet so schnell keine Stelle mehr - und die CDU hat auch nicht genug Geld, um viele neue Referenten einzustellen.
Andere Skalpe übrigens hier und hier
Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Wilkhahn ist nicht billig. Dafür ist es hervorragende Qualität, hält ewig und entspricht deshalb heute mehr dem Bauhausideal als all die billigen Marcel-Breuer-Kopien, die nach 2 Jahren reif für den Müll sind. Langfristig gesehen, ist Wilkhahn auch wegen der ergonomischen Form günstig - rechnet man staatlicherseits die dadurch vermiedenen Rückenprobleme rein, ist die Total Cost of Ownership geringer als bei dem billigen Ramsch, den so ein Steuerzahlerbunds-Apparatschik einem Politiker wünschen würde.
Gerade auf dem Höhepunkt der New Economy 1999/2000 wurde Wilkhahn gekauft, als gäb´s kein morgen morgen mehr. Weniger von Startups, die eher den dynamischen Eames den Vorzug gaben, als vielmehr von Banken, Finanzdienstleistern, VCs und Investmentberatern. Die 1100 Euro (ohne Mehrwertsteuer), die so ein Einstiegs-Freischwinger kostet, zahlten die damals aus der Portokasse

Vor ein paar Wochen bin ich mit einer Person zusammengeraten, die sich ganz in IBM-blau im Internet als jpg wiederfindet. Sehr selbstüberzeugt, der Herr; meinte, er habe schon den Spiegel und den Stern in die Knie gezwungen. Für ordentliches Briefpapier hat es trotzdem nicht gereicht; sein Schreiben kam als Ausdruck vom Tintenstrahldrucker mit erheblichen Farbschwächen. Erinnerte mehr an die "Verkaufen Sie mir Ihr Auto"-Fitzel, die sie einem hier in Berlin a.d. Spree in die Aussenspiegel stecken.
Man tut solchen Leuten dummerweise dann die Ehre, sie zu googlen. In diesem Fall kam raus, dass unter seiner Geschäftskunden auch Personen zu finden sind, die im Skandal rund um die Berliner Bankgesellschaft öfters in den Medien waren, als es ihnen lieb sein konnte. Ihre kritisierten Handlungen betrieben sie ebenfalls von der Wilkhahn FS-Linie herab, denn die BB schwor auf Qualität bei den Möbeln mehr, als bei den Investments.
Mittlerweile jedoch sind die betreffenden Personen von ihren Posten radikal entfernt worden, und das ist auch gut so. Aber weil sich bekanntlich bei notorischen Verschwendern nie was ändert, werden jetzt auch gleich noch ihre Sitzgelegenheiten mitsamt Eigentumsaufkleber an der Unterseite entsorgt. Wahrscheinlich hat man die Stühle weggeworfen, denn anders ist es nicht zu verstehen, wenn sie jetzt, perfekt gepflegt und fast nicht benützt, für 30 Euro das Stück beim Händler des Vetrauens verramscht werden - der übrigens darauf schwört, dass diese Stühle 100 Euro im Laden kosten. Nach dem Aufeinanderprall zweier orientalischer Charaktere sind es dann übrigens nur noch 20 Euro pro Stuhl, wie der, auf dem ich jetzt gerade sitze, und das typische Wilkhahn-Feeling habe, wie damals, 2000 bei einem VC hoch über der Leopoldstrasse...
Und mir überlege, auf was für einem billigen Ikea-Gerümpel gerade sein Vorbesitzer sitzen mag. Denn wer bei der BB rausfliegt und am Skandal beteiligt war, findet so schnell keine Stelle mehr - und die CDU hat auch nicht genug Geld, um viele neue Referenten einzustellen.
Andere Skalpe übrigens hier und hier
donalphons, 20:33h
... link (4 Kommentare) ... comment
: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :
Mittwoch, 2. Juni 2004
Mehr Skalpe meiner Feinde
Mit dem Psion Revo verbinde ich eine Besprechung der besonderen Art. Das ist jetzt etwas mehr als 4 Jahre her, in diesem traumhaft warmen Frühling des Jahres 2000. Es gab so gewisse Anzeichen einer leichten Krise in der New Economy, die mich nicht besonders betrafen, denn ich war ohnehin kurzzeitig kaltgestellt. Und ich hatte für ein anderes Dasein im Ausland zu tun.
Eingeladen hatte der Vorstand eines Unternehmens, das am Neuen Markt gehandelt wurde. Es ging um Avatar-Technologien, Kooperationen mit grossen Computerherstellern und, wie damals üblich, um die Gewissheit, die Nummer Eins zu werden. Es gab 2000 etwa ein Dutzend Konkurrenten; schnell gewachsene Konglomerate, amorph, schemenhaft, schwammig wie eine giftige Qualle und in etwa so freundlich in der Wahl der Mittel. Die anwesenden Journalisten hatten fühlbar Angst vor dem Mann, der auf dem Ehrenplatz weitschweifig seine Strategie erklärte.
Rechts von mir sass eine junge Frau; eigentlich viel zu jung für den Business Suit, den sie trug, und sah aus und roch wie eine lebende Werbung für diese trockenen, kühlen Parfums, die Frauen damals nutzten, um hart und abgebrüht zu erscheinen. Sie hatte unfassbar zierliche Hände und schrieb auf dem Psion Revo mit, der genau in die aufgesetzte Jackentasche gepasst hatte.

Die schwungvolle Biegung des Revo-Gehäuses setzte sich in ihren Händen, den Armen und dem Körper fort. Der winzige Computer schien mit ihr eine Einheit zu werden, und sie hatte die Lippen beim Schreiben immer leicht geöffnet. Wenn sie innehielt, lächelte sie spöttisch, als würde sie all die schönen Worte nicht glauben.
Ich war eigentlich nur wegen des Essens gekommen. Aber der Vorstand sprach ohne Ende, und ich konnte sie lange, sehr lange anschauen. Als der Vorstand in Worten die Weltherrschaft übernommen hatte und der erste Gang aufgetragen wurde, klappte sie flink den Revo zusammen, ging vor, gab ihm ihre Visitenkarte, sprach kurz mit ihm, und ging. Sie hatte wohl keine Lust auf Networking und all das gestellte, gestelzte Pfauengetue der Szene. Sie unterwarf sich in Kleidung, Geruch und Revo, aber sie war nicht bestechlich. Eine harte, ehrliche Arbeiterin. Dachte ich.
Am nächsten Tag las ich ihren Artikel im Internet, und er passte in seiner schleimigen, hündischen Haltung nicht im Mindesten zu dem, was in meiner Phantasie mit dem Mädchen zu verbinden war. Da war ein fundamentaler Gegensatz, traurig, unfassbar, Zeichen eines Missverständnisses. Da war noch etwas anderes unter der glatten Oberfläche dieser Frau, aber wahrscheinlich lag darunter eine weitere Ebene, und die war karrieregeil, abgebrüht und in jeder Hinsicht anpassungsfähig. Vielleicht täuschte sie sich selbst gerne mit ihrem zynischen Lächeln. Vielleicht wollte sie das an Anderen verachten, was sie selbst an der Oberfläche und im Kern war. Die Vielschichtigkeit des Bösen.
Geholfen hat es ihr nicht. Ein paar Wochen später wurde das Internet-Projekt, bei dem sie gearbeitet hatte, eingestellt. In gewisser Weise wurde sie dann noch ein Vorbild für einen Charakter in meinem Buch, auch wenn sie dort keinen Revo hat - der fiel aus Gründen der leichteren Verständlichkeit einer Digitalkamera zum Opfer. Wer kennt schon einen Revo?
Letztes Wochende habe ich zufällig einen fast neuen Revo entdeckt und gekauft, als Erinnerung an die schlechten, alten Zeiten. Die Form ist immer noch sehr elegant, auch wenn er nur einen Bruchteil des früheren Preises gekostet hat. Das Mädchen, vermute ich, sieht sicher auch noch elegant aus; Hände ändern sich kaum, und vielleicht hat sie ihren Revo noch, aus dieser sagenhaften Zeit, als man für ihn - und sie - noch den hohen Originalpreis zahlen musste.
Soweit ich weiss, hat sie es nicht in einen geregelten Job geschafft. Google kennt ihren Namen nicht mehr.
Eingeladen hatte der Vorstand eines Unternehmens, das am Neuen Markt gehandelt wurde. Es ging um Avatar-Technologien, Kooperationen mit grossen Computerherstellern und, wie damals üblich, um die Gewissheit, die Nummer Eins zu werden. Es gab 2000 etwa ein Dutzend Konkurrenten; schnell gewachsene Konglomerate, amorph, schemenhaft, schwammig wie eine giftige Qualle und in etwa so freundlich in der Wahl der Mittel. Die anwesenden Journalisten hatten fühlbar Angst vor dem Mann, der auf dem Ehrenplatz weitschweifig seine Strategie erklärte.
Rechts von mir sass eine junge Frau; eigentlich viel zu jung für den Business Suit, den sie trug, und sah aus und roch wie eine lebende Werbung für diese trockenen, kühlen Parfums, die Frauen damals nutzten, um hart und abgebrüht zu erscheinen. Sie hatte unfassbar zierliche Hände und schrieb auf dem Psion Revo mit, der genau in die aufgesetzte Jackentasche gepasst hatte.

Die schwungvolle Biegung des Revo-Gehäuses setzte sich in ihren Händen, den Armen und dem Körper fort. Der winzige Computer schien mit ihr eine Einheit zu werden, und sie hatte die Lippen beim Schreiben immer leicht geöffnet. Wenn sie innehielt, lächelte sie spöttisch, als würde sie all die schönen Worte nicht glauben.
Ich war eigentlich nur wegen des Essens gekommen. Aber der Vorstand sprach ohne Ende, und ich konnte sie lange, sehr lange anschauen. Als der Vorstand in Worten die Weltherrschaft übernommen hatte und der erste Gang aufgetragen wurde, klappte sie flink den Revo zusammen, ging vor, gab ihm ihre Visitenkarte, sprach kurz mit ihm, und ging. Sie hatte wohl keine Lust auf Networking und all das gestellte, gestelzte Pfauengetue der Szene. Sie unterwarf sich in Kleidung, Geruch und Revo, aber sie war nicht bestechlich. Eine harte, ehrliche Arbeiterin. Dachte ich.
Am nächsten Tag las ich ihren Artikel im Internet, und er passte in seiner schleimigen, hündischen Haltung nicht im Mindesten zu dem, was in meiner Phantasie mit dem Mädchen zu verbinden war. Da war ein fundamentaler Gegensatz, traurig, unfassbar, Zeichen eines Missverständnisses. Da war noch etwas anderes unter der glatten Oberfläche dieser Frau, aber wahrscheinlich lag darunter eine weitere Ebene, und die war karrieregeil, abgebrüht und in jeder Hinsicht anpassungsfähig. Vielleicht täuschte sie sich selbst gerne mit ihrem zynischen Lächeln. Vielleicht wollte sie das an Anderen verachten, was sie selbst an der Oberfläche und im Kern war. Die Vielschichtigkeit des Bösen.
Geholfen hat es ihr nicht. Ein paar Wochen später wurde das Internet-Projekt, bei dem sie gearbeitet hatte, eingestellt. In gewisser Weise wurde sie dann noch ein Vorbild für einen Charakter in meinem Buch, auch wenn sie dort keinen Revo hat - der fiel aus Gründen der leichteren Verständlichkeit einer Digitalkamera zum Opfer. Wer kennt schon einen Revo?
Letztes Wochende habe ich zufällig einen fast neuen Revo entdeckt und gekauft, als Erinnerung an die schlechten, alten Zeiten. Die Form ist immer noch sehr elegant, auch wenn er nur einen Bruchteil des früheren Preises gekostet hat. Das Mädchen, vermute ich, sieht sicher auch noch elegant aus; Hände ändern sich kaum, und vielleicht hat sie ihren Revo noch, aus dieser sagenhaften Zeit, als man für ihn - und sie - noch den hohen Originalpreis zahlen musste.
Soweit ich weiss, hat sie es nicht in einen geregelten Job geschafft. Google kennt ihren Namen nicht mehr.
donalphons, 03:17h
... link (5 Kommentare) ... comment
: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :
Samstag, 10. April 2004
Die Skalpe meiner Feinde
Es gab so eine Zeit, rund um das Jahr 2000, da bekam man die Beratungsprojekte nicht auf CD-Roms, sondern auf einem alten Laptop. Auf der einen Seite konnte man so relativ sicher sein, dass nicht sofort die CDs die Runde machten. Und wie der Zufall es haben wollte, waren manchmal die Anschlüsse der Laptops verklebt oder unterbrochen. Einer gewissen Beliebtheit erfreuten sich damals Compaqs der Serie 4220T, ehemals astronomisch teure Teile, 1998 sehr fortschrittlich, nur ohne USB und CD-Laufwerk.
Nach Ende der Arbeit wurden die Daten gelöscht, und man konnte den Laptop behalten - 2000 waren sie mit ihren 12.1-Zoll-Displays und 266er Prozessoren rettungslos veraltet. Zumindest für die Startups, bei denen es nie an Laptops mangelte.
Als mein Buch erschien, fragte mich eine IT-Journalistin im Interview, wieviele Rechner ich eigentlich habe. Damals hatten sich 5 Laptops angesammelt: Neben meinem eigenen Siemens ein Compaq Aero 8000 aus der Zeit, als Compaq zerschlagen wurde, zwei Compaq 4220T, ein HP Omnibook - alle in der grossen Zeit oder kurz danach auf die eine oder andere Art bekommen, als Bonus verdient, oder schlichtweg nicht mehr abgeholt, weil die Firma dahinter nicht mehr existierte.
Mit jedem Rechner verbindet sich eine Geschichte, und auch ein Schicksal, denn alle, die mir die Laptops gaben, hat es bald danach aus ihrer Lebensbahn geworfen. Manche schlimm, andere total. Das waren damals grossspurige Angeber, phantastische Aufreisser, Lügner, teilweise auch schlicht Kriminelle.
Andere Geschichten haben keine Fragmente in meiner Realität hinterlassen. Die grosse Zeit der New Economy ging 2001 für immer unter, und keiner verschenkte mehr Laptops. Die wurden benutzt, bis sie Schrott waren. Für Neuanschaffungen war kein Geld mehr da.
Einer der Typen, mit denen ich in der Endphase zu tun hatte, ist vor ein paar Monaten endlich pleite gegangen. Der Insolvenzverwalter langt richtig hin, und der frühere leitende Angestellte musste alles abgeben: Firmenwagen, Firmenrechner, Firmenkarten. Was an Assets da ist, wird bei ebay verkauft. Tatsächlich fand ich jetzt die Reste: Die Möbel, die billigen Acers der normalen Mitarbeiter, und die executive Compaqs M700 der Manager. Kosteten damals gut und gerne 6500 Euro, erzählte man mir damals, mit allen Schikanen, aber man leistete sich ja sonst nichts, ausser einem Dienst-Z3.
Jetzt ist sein Laptop von früher zu haben. Nicht dass ich ihn bräuchte. Aber ich werde ihn wahrscheinlich kaufen. Um manchmal, so wie er damals, mit dem Finger über die Magnesiumhülle zu gleiten, und zu überlegen, was jetzt wohl aus ihm geworden ist. Google verrät nichts dazu. Nicht gut, das.
Nach Ende der Arbeit wurden die Daten gelöscht, und man konnte den Laptop behalten - 2000 waren sie mit ihren 12.1-Zoll-Displays und 266er Prozessoren rettungslos veraltet. Zumindest für die Startups, bei denen es nie an Laptops mangelte.
Als mein Buch erschien, fragte mich eine IT-Journalistin im Interview, wieviele Rechner ich eigentlich habe. Damals hatten sich 5 Laptops angesammelt: Neben meinem eigenen Siemens ein Compaq Aero 8000 aus der Zeit, als Compaq zerschlagen wurde, zwei Compaq 4220T, ein HP Omnibook - alle in der grossen Zeit oder kurz danach auf die eine oder andere Art bekommen, als Bonus verdient, oder schlichtweg nicht mehr abgeholt, weil die Firma dahinter nicht mehr existierte.
Mit jedem Rechner verbindet sich eine Geschichte, und auch ein Schicksal, denn alle, die mir die Laptops gaben, hat es bald danach aus ihrer Lebensbahn geworfen. Manche schlimm, andere total. Das waren damals grossspurige Angeber, phantastische Aufreisser, Lügner, teilweise auch schlicht Kriminelle.
Andere Geschichten haben keine Fragmente in meiner Realität hinterlassen. Die grosse Zeit der New Economy ging 2001 für immer unter, und keiner verschenkte mehr Laptops. Die wurden benutzt, bis sie Schrott waren. Für Neuanschaffungen war kein Geld mehr da.
Einer der Typen, mit denen ich in der Endphase zu tun hatte, ist vor ein paar Monaten endlich pleite gegangen. Der Insolvenzverwalter langt richtig hin, und der frühere leitende Angestellte musste alles abgeben: Firmenwagen, Firmenrechner, Firmenkarten. Was an Assets da ist, wird bei ebay verkauft. Tatsächlich fand ich jetzt die Reste: Die Möbel, die billigen Acers der normalen Mitarbeiter, und die executive Compaqs M700 der Manager. Kosteten damals gut und gerne 6500 Euro, erzählte man mir damals, mit allen Schikanen, aber man leistete sich ja sonst nichts, ausser einem Dienst-Z3.
Jetzt ist sein Laptop von früher zu haben. Nicht dass ich ihn bräuchte. Aber ich werde ihn wahrscheinlich kaufen. Um manchmal, so wie er damals, mit dem Finger über die Magnesiumhülle zu gleiten, und zu überlegen, was jetzt wohl aus ihm geworden ist. Google verrät nichts dazu. Nicht gut, das.
donalphons, 17:37h
... link (6 Kommentare) ... comment