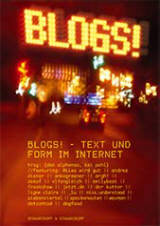... newer stories
Sonntag, 30. April 2006
Date mit Walburga
Ich hatte mit Frau D. nichts zu tun. Frau D. hatte ich – mit einer Ausnahme - nur gesehen, ab und zu geisterten wenig erbauliche Geschichten über sie durch das Klassenzimmer, in dem ich meine ersten beiden Schuljahre durchbrachte. Die anderen lernten sie bald kennen – und auch den Mann, in dessen Auftrag sie unterwegs war.
Denn in dieser Schule im tiefsten Bayern gab es neben der staatlichen Autorität, repräsentiert von Frau G., auch noch eine andere Macht. Für 29 der 30 Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b war diese Macht Frau D.. 29 Schüler hatten Erfahrungen gemein, bei denen ich ausgeschlossen war. Im Prinzip war es kein Problem, bedeutete es doch, dass ich 2 Stunden Schule pro Woche weniger hatte als die anderen. Die anderen waren katholisch – ich war es nicht. Ich war ein Treppenwitz der Geschichte, eine Lücke im Heilsplan von Frau D., den zu beheben ihr nicht vergönnt war. Nur einmal, zu Beginn der ersten Klasse, wurde ich mehr oder weniger willenlos in den Religionsunterricht gebracht. Was da von Frau D. erzählt wurde, weiss ich nicht mehr, aber ich habe dann zu Hause erzählt, dass ich eben in diesem Unterricht war. Am nächsten Tag war dann meine Mutter in der Schule, sprach mit dem Direktor, und mir wurde gesagt, dass ich in Zukunft nicht mehr in diesen Unterricht kommen sollte.
Frau D. war in der Folge nicht mehr gut auf mich zu sprechen, schien mir, denn in ihrem Unterricht wurde nicht nur gebetet und gemalt – so komische genagelte Leute auf Balken und Füsse, die aus dem Himmel baumeln, und was da sonst noch in den Malblöcken meiner Kameraden war. Den Kindern wurden auch Geschichten erzählt von gut und böse, von Himmel und Hölle und davon, dass die Evangelen aus der Parallelklasse 1c wohl nicht so leicht in den Himmel kommen würden. Die durften auch keine roten Kerle mit Zipfelmützen und Engel und all so Zeug malen. Die hatte der liebe Gott nicht so lieb. Besonders unlieb aber, so Frau D., hatte der liebe Gott die anderen, die nicht an seinen Sohn glaubten. Und ihn statt dessen umgebracht hatten. Die würden später mal bitter zahlen, in der Hölle. Das waren die Juden. Von denen es durch Zufall einen an der Schule gab. Mich.
Aber wie Kinder nun mal so sind, die Höllenfeuer sind fern: Die Bonanzaräder und die Paninibilder dagegen sehr nah. Hin und wieder auf den Dreckbergen hinter unserer Siedlung, in unseren selbstgegrabenen Burgen, berichtete mancher, was die D. wieder gesagt hatte, über Juden wie mich, die Feinde des HerrGotts. Manchmal erzählten sie auch von dem Mann hinter ihr, den sie in der Folge kennengelernt hatten; den Stadtpfarrer K., der später ins Gerede kam, weil er das Geld der Sammelbüchsen für die kleinen afrikanischen Neger für den Blumenschmuck seiner hässlichen gelben Kirche verwendete, die zu betreten mir aber versagt blieb. Meine Eltern, die ich fragte, ob sie oder Oma denn auch diesen Christus da gekreuzigt hätten, so wie es auf den Zeichnung zu sehen war, mit viel Wasserfarben-Blut und riesigen Kugelschreibernägeln in den Armen, und wie es verkündet wurde vom Stadtpfarrer K. zu St Josef – meine Eltern also intervenierten ein zweites Mal, und danach war Ruhe. Erstmal.
Die erste Klasse ging vorüber, der Winter kam und wieder ein Frühling, die anderen mussten am Ende in einen Gottesdienst, während ich auf der Schaukel im Garten sass und mich des Daseins freute. Dann kamen die Ferien, und dann wieder die Schule. Und der Schulausflug. Frau G. sagte, dass wir in das Altmühltal fahren, und nach Eichstätt, und auf dem Hinweg auch in der Linde einkehrten. Die Linde war ein grandioses Ausflugslokal, in das meine Eltern oft mit mir fuhren, mit fantastischen Kartoffelknödeln, die ich damals gern roh verschlang, aber gleich vier Stück auf einmal. Alles wies auf einen traumhaft schönen Tag mit einem kulinarischen Höhepunkt hin, als wir in den Bus einstiegen. Die Sonne lachte uns unschuldige Kinder an, und als wir sassen und anfingen, die Sunkistbeutel zu tauschen, dachte ich mir nichts böses. Auch als der Bus hinter der Schule anhielt, vor der schwefelgelben St.Josefskirche, keimte kein Verdacht in mir ob des Schreckens, das da kommen sollte. In den Bus stiegen Frau D. und der Stadtpfarrer K.....
Den schaurigen Rest mit der gesamten Wallburgageschichte gibt es dann heute Abend im Twisted Bavarian in der Tengstrasse 20.
Und während der Bus durch das saftige Grün der Juraanhöhen glitt, im warmen Glanz des Spätsommers, das durch die Blätter und Zweige flackerte, während uns die Idylle und Pracht dieser weitgehend unberührten Landschaft umschloss mit ihren weissen Kalkfelsen, den dunklen Äckern und den hohen Bäumen, da trat dann also Pfarrer K. in die Mitte des Buses, und sprach: Dass wir uns nachher bei der heiligen Wallburga ordentlich verhalten sollten, sonst – schebbats. Mitte der 70er Jahre galten Ohrfeigen, zumindest für Herrn K., noch als probates Mittel zur Erziehung.
Der Auftritt vom Pfarrer und die Erwähnung besagter Heiliger hätte mich misstrauisch machen sollen, allein, was soll´s, für mich galt er ja nicht, weshalb ich später in der Hölle sein würde – was mir als durchaus lohnender Tausch erschien angesichts der Angstzustände, die sich wegen dieser Ansprache bei Freund und Feind breit machte. Und Feinde gab es natürlich auch, der dicke Jürgen zum Beispiel, und seine Freunde. Jürgen hatte mich beim Tausch der Schlumpfbilder übers Ohr gehauen, die wir zusammen mit den Wundertüten im Laden hinter der Schule gekauft hatten. Ich hatte mich später damit gerächt, dass ich meiner Mutter das grosse Geodreieck entwendete und bei der nächsten Linealfechterei von der harmlosen Hieb zur ungleich effektiveren, da Wunden verursachenden Stichwaffe überging.
Nach der Ansprache des Stadtpfarrers wurde dann auch mir mitgeteilt, was es denn mit der Wallburga, der D. und dem K. auf sich hatte: In Eichstätt liegt diese Heilige begraben, und irgendwie hatten es die fette Blondine und der kugelrunde Pfarrer mit seinem enormen Nasenhaarwuchs geschafft, den Klassenausflug dorthin umzuleiten. Der Bus fuhr, zum Aussteigen war es zu spät, und ein Handy, mit dem ich meine Mutter hätte anrufen können, gab es damals nicht. Und so glitt der Bus weiterhin seinem Ziel entgegen, immer noch im satten Grün des traumhaft schönen Sommers, aber mit einem etwas unsicheren Kind auf der hinteren Bank, das nicht wusste, ob es sich freuen sollte, jetzt auch mal so eine Kirche zu erleben, oder ob es nicht einfach Angst haben sollte vor dem Ungewissen, das da an einer Flussbiegung, im tiefen Gemäuer vergraben, auf ihn wartete.
Irgendwann kam der Bus auf einem Platz an, wir stiegen aus, und der Pfarrer K. erzählte die Geschichte der heiligen Wallburga: Eine Königstochter aus England, die nach Deutschland kam, um die Heiden zu missionieren und deshalb heilig war. Irgendwann starb sie und wurde hier begraben, aber sie tue immer noch Wunder, besonders durch das Walburgisöl, das wir später kaufen sollten. Keinesfalls aber habe sie etwas mit dem „Heia Walpurgisnacht-wenn der Mond vom Himmel lacht“-Gesängen zu tun, die mir nicht unbekannt waren – im Frühling zuvor hatte ich, dasselbige singend, versucht, beim Hexentanz in Frau Martins Garten den Kirschbaum abzufackeln, an den ich vorher mit Hilfe ihrer Tochter Bettina die andere Tochter Vreni gefesselt hatte.
Das also war es nicht, was uns in der hochaufragenden Kirche erwartete. Über eine Treppe ging es hinauf, dann öffnete sich das Tor, ich ging hinein – und der Sommer war vorbei. Kühl und modrig war es in dem Gemäuer, durch die kleinen Fenster fiel wenig Licht auf die fast schwarzen Wände. Beim genaueren Hinsehen entpuppte sich die Wandfarbe als endlose Fläche von kleinen, dunklen Bildern, auf denen Menschen mit allen möglichen Gebrechen zu sehen waren. Da wurde geschossen, Knochen entzweiht und vom Wagen gefallen, da stürzten Menschen in Schluchten, und alle waren sie unsagbar hässlich, grob gemalt und voller grausamer Details. Wo keine Bilder hingen, waren abnorme Krücken an die Wand genagelt, oder auch Ketten, Handschellen und Halseisen. Das alles, erklärte uns Frau D., seien die Gaben von Leuten, die die heilige Walburga geheilt hatte, auch das da in dem Kasten – und sie wies auf die rechte Wand, wo ein roter Fleck unter all dem Schwarz hervorstach. Wir gingen hinüber. Der rote Fleck erwies sich als mit Samt ausgeschlagener Schaukasten, in dem Knochensplitter, Kugeln, Magensteine, böse Zähne und viele andere Körperteile ausgestellt waren. Ein Magenstein, so gross wie eine Faust, hatte die Form eines Herzens, ein aschfahles, pickliges Herz in einer schwarz angelaufenen Silberfassung. Die Zähne waren braun, abgekaut, zerborsten oder lange, schiefe Missbildung, manchmal noch mit Kochensplittern daran. Menschentrümmer in allen Varianten, zackig, geborsten, morsch und faulig. Was immer in den diversen Glasampullen war – Eiter, Ausfluss, Blut – es war dunkel-klebrig eingetrocknet und verharzt. Frau D. erklärte, welch grosses Leid den Menschen genommen worden war, ich hingegen begann, dasselbige inzwischen im Magen zu verspüren, in den tiefsten Eingeweiden, die seit dem Frühstück auf Knödel, goldgelbe saftige Knödel warteten, und nun vom Anblick dieser Trümmer gepeinigt und aufgewühlt wurden. Jürgen, die Strebersau, und auch einige andere knieten sich auf Frau D.s Kommando hin und sagten ein Gebet auf, während ich mich in Richtung Ausgang drückte. Doch der erwies sich als vom Pfarrer K. blockiert.
Und etzad gemma nunta, sagte der Stadtpfarrer, und wies mir und den Nachfolgenden den Weg eine Treppe hinab in das Erdreich unter diesem schwarzen Saal. Es öffnete sich ein kleiner Raum, wo wir eng zusammengedrängt an einem Gitter standen. Dahinter leuchtete fahl ein grosser, weisser, rechteckiger Streinsarg – und in dem, so erklärte uns der nachgekeuchte Stadtpfarrer, befinde sich die Wallburga, die all die Wunder mache. Und das geht so: Zu einer gewissen Zeit im Frühjahr tropft aus diesem Sarg, in dem Wallburga liegt, ein Öl, das die Nonnen hier auffangen. Das Öl wirkt Wunder, heilt und segnet alles, was damit in Berührung kommt, und wir alle werden dadurch gesegnet. Jetzt. Gleich. Und auf der anderen Seite, über eine zweite Treppe, kam eine finstere Gestalt herunter, über und über schwarz, mit einem Kästchen in der Hand, und trat auf uns zu. Es war eine hässliche, verschrumpelte alte Frau in diesem dunklen, stinkenden Loch unter der Erde, neben uns lag diese Leiche in ihrem Sarg und badete in diesem Verwesungsöl aus ihrem Körper, ich konnte es riechen, dieses saftige, stinkende, schwarz aufgedunsene Kadaver mit wirren Haaren, borstig und abstossend wie das Gewächs aus des Stadtpfarrers Nase, und der gleiche verfaulte Saft war in den Ampullen, die im Kästchen auf uns warteten. Der K. postierte sich neben ihr, zwei alte Fleischklumpen in der Finsternis, und hinter uns machte Frau D. die Räume dicht. Das erste Kind musste vortreten, der Pfarrer tauchte seine Pranke in eine Schale mit diesem Leichenöl, streckte, murmelnd, die Hand aus und machte ein Kreuz auf dessen Stirn. Das Kind musste eine Ampulle nehmen, die schwarze Krähe steckte die Hand aus, um eine Gabe zu nehmen. Es war nicht der Gedanke, dass ich da auch zahlen müsste und deshalb nachher in der Linde einen oder zwei Knödel weniger essen könnte, es war auch nicht die lange Reihe meiner Mitschüler, die sich wie willenlose Zombies für das Ritual einreihten, hier unter der Erde, mit den schwarzen Bildern, den Nierensteinen über und der in Öl eingelegten Wallburga neben uns, es war nicht der K. und das Ritual und auch nicht die massige Figur der D. in dieser Szene – letztlich war es Jürgen, der Schlumpfbildbescheisser, der sich zu mir umdrehte, meine Panik erkannte und sagte: Du bekommst kein Kreuz, du musst das Öl trinken, und meines bekommst Du auch.
Ich drehte mich um, presste mich am Fleischberg von Frau D. vorbei, der ins Wanken geriet, raste die Treppe hoch und rannte, ohne noch einen Blick auf die schwarzen Tafeln, die Gallensteine und Krücken zu werfen, auf die Tür zu, wo ich in eine Gruppe Touristen knallte, an ihnen vornbei hinein in das gleissende Licht, in den unfassbar schönen Sommer, in die klare, reine Luft des Jura, von Helligkeit durchdrungen und gereinigt von all der Verwesung, die mich zu umfangen drohte, unendlich weit weg vom K., der schwarzen Frau und dem Kadaver im fahlen Stein und seinem schleimigen Öl, das meiner im Bauch der Erde harrte.
Kurz darauf war das jüdische Neujahrsfest Rosch ha Schana, an dessen Ende es zu Jom Kippur Geschenke für die Kinder gibt. Meine Mutter war sehr zufrieden mit ihrem mathematisch interessierten Sohn, der von den bislang gewünschten Ritterfiguren Abstand nahm und ein 35 Zentimeter langes, spitzwinkliges Geodreieck haben wollte, lang genug, um notfalls auch einen fetten Stadtpfarrer zu erstechen, falls er ihm mit dem Saft der Wallburga zu nahe kam.
Denn in dieser Schule im tiefsten Bayern gab es neben der staatlichen Autorität, repräsentiert von Frau G., auch noch eine andere Macht. Für 29 der 30 Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b war diese Macht Frau D.. 29 Schüler hatten Erfahrungen gemein, bei denen ich ausgeschlossen war. Im Prinzip war es kein Problem, bedeutete es doch, dass ich 2 Stunden Schule pro Woche weniger hatte als die anderen. Die anderen waren katholisch – ich war es nicht. Ich war ein Treppenwitz der Geschichte, eine Lücke im Heilsplan von Frau D., den zu beheben ihr nicht vergönnt war. Nur einmal, zu Beginn der ersten Klasse, wurde ich mehr oder weniger willenlos in den Religionsunterricht gebracht. Was da von Frau D. erzählt wurde, weiss ich nicht mehr, aber ich habe dann zu Hause erzählt, dass ich eben in diesem Unterricht war. Am nächsten Tag war dann meine Mutter in der Schule, sprach mit dem Direktor, und mir wurde gesagt, dass ich in Zukunft nicht mehr in diesen Unterricht kommen sollte.
Frau D. war in der Folge nicht mehr gut auf mich zu sprechen, schien mir, denn in ihrem Unterricht wurde nicht nur gebetet und gemalt – so komische genagelte Leute auf Balken und Füsse, die aus dem Himmel baumeln, und was da sonst noch in den Malblöcken meiner Kameraden war. Den Kindern wurden auch Geschichten erzählt von gut und böse, von Himmel und Hölle und davon, dass die Evangelen aus der Parallelklasse 1c wohl nicht so leicht in den Himmel kommen würden. Die durften auch keine roten Kerle mit Zipfelmützen und Engel und all so Zeug malen. Die hatte der liebe Gott nicht so lieb. Besonders unlieb aber, so Frau D., hatte der liebe Gott die anderen, die nicht an seinen Sohn glaubten. Und ihn statt dessen umgebracht hatten. Die würden später mal bitter zahlen, in der Hölle. Das waren die Juden. Von denen es durch Zufall einen an der Schule gab. Mich.
Aber wie Kinder nun mal so sind, die Höllenfeuer sind fern: Die Bonanzaräder und die Paninibilder dagegen sehr nah. Hin und wieder auf den Dreckbergen hinter unserer Siedlung, in unseren selbstgegrabenen Burgen, berichtete mancher, was die D. wieder gesagt hatte, über Juden wie mich, die Feinde des HerrGotts. Manchmal erzählten sie auch von dem Mann hinter ihr, den sie in der Folge kennengelernt hatten; den Stadtpfarrer K., der später ins Gerede kam, weil er das Geld der Sammelbüchsen für die kleinen afrikanischen Neger für den Blumenschmuck seiner hässlichen gelben Kirche verwendete, die zu betreten mir aber versagt blieb. Meine Eltern, die ich fragte, ob sie oder Oma denn auch diesen Christus da gekreuzigt hätten, so wie es auf den Zeichnung zu sehen war, mit viel Wasserfarben-Blut und riesigen Kugelschreibernägeln in den Armen, und wie es verkündet wurde vom Stadtpfarrer K. zu St Josef – meine Eltern also intervenierten ein zweites Mal, und danach war Ruhe. Erstmal.
Die erste Klasse ging vorüber, der Winter kam und wieder ein Frühling, die anderen mussten am Ende in einen Gottesdienst, während ich auf der Schaukel im Garten sass und mich des Daseins freute. Dann kamen die Ferien, und dann wieder die Schule. Und der Schulausflug. Frau G. sagte, dass wir in das Altmühltal fahren, und nach Eichstätt, und auf dem Hinweg auch in der Linde einkehrten. Die Linde war ein grandioses Ausflugslokal, in das meine Eltern oft mit mir fuhren, mit fantastischen Kartoffelknödeln, die ich damals gern roh verschlang, aber gleich vier Stück auf einmal. Alles wies auf einen traumhaft schönen Tag mit einem kulinarischen Höhepunkt hin, als wir in den Bus einstiegen. Die Sonne lachte uns unschuldige Kinder an, und als wir sassen und anfingen, die Sunkistbeutel zu tauschen, dachte ich mir nichts böses. Auch als der Bus hinter der Schule anhielt, vor der schwefelgelben St.Josefskirche, keimte kein Verdacht in mir ob des Schreckens, das da kommen sollte. In den Bus stiegen Frau D. und der Stadtpfarrer K.....
Und während der Bus durch das saftige Grün der Juraanhöhen glitt, im warmen Glanz des Spätsommers, das durch die Blätter und Zweige flackerte, während uns die Idylle und Pracht dieser weitgehend unberührten Landschaft umschloss mit ihren weissen Kalkfelsen, den dunklen Äckern und den hohen Bäumen, da trat dann also Pfarrer K. in die Mitte des Buses, und sprach: Dass wir uns nachher bei der heiligen Wallburga ordentlich verhalten sollten, sonst – schebbats. Mitte der 70er Jahre galten Ohrfeigen, zumindest für Herrn K., noch als probates Mittel zur Erziehung.
Der Auftritt vom Pfarrer und die Erwähnung besagter Heiliger hätte mich misstrauisch machen sollen, allein, was soll´s, für mich galt er ja nicht, weshalb ich später in der Hölle sein würde – was mir als durchaus lohnender Tausch erschien angesichts der Angstzustände, die sich wegen dieser Ansprache bei Freund und Feind breit machte. Und Feinde gab es natürlich auch, der dicke Jürgen zum Beispiel, und seine Freunde. Jürgen hatte mich beim Tausch der Schlumpfbilder übers Ohr gehauen, die wir zusammen mit den Wundertüten im Laden hinter der Schule gekauft hatten. Ich hatte mich später damit gerächt, dass ich meiner Mutter das grosse Geodreieck entwendete und bei der nächsten Linealfechterei von der harmlosen Hieb zur ungleich effektiveren, da Wunden verursachenden Stichwaffe überging.
Nach der Ansprache des Stadtpfarrers wurde dann auch mir mitgeteilt, was es denn mit der Wallburga, der D. und dem K. auf sich hatte: In Eichstätt liegt diese Heilige begraben, und irgendwie hatten es die fette Blondine und der kugelrunde Pfarrer mit seinem enormen Nasenhaarwuchs geschafft, den Klassenausflug dorthin umzuleiten. Der Bus fuhr, zum Aussteigen war es zu spät, und ein Handy, mit dem ich meine Mutter hätte anrufen können, gab es damals nicht. Und so glitt der Bus weiterhin seinem Ziel entgegen, immer noch im satten Grün des traumhaft schönen Sommers, aber mit einem etwas unsicheren Kind auf der hinteren Bank, das nicht wusste, ob es sich freuen sollte, jetzt auch mal so eine Kirche zu erleben, oder ob es nicht einfach Angst haben sollte vor dem Ungewissen, das da an einer Flussbiegung, im tiefen Gemäuer vergraben, auf ihn wartete.
Irgendwann kam der Bus auf einem Platz an, wir stiegen aus, und der Pfarrer K. erzählte die Geschichte der heiligen Wallburga: Eine Königstochter aus England, die nach Deutschland kam, um die Heiden zu missionieren und deshalb heilig war. Irgendwann starb sie und wurde hier begraben, aber sie tue immer noch Wunder, besonders durch das Walburgisöl, das wir später kaufen sollten. Keinesfalls aber habe sie etwas mit dem „Heia Walpurgisnacht-wenn der Mond vom Himmel lacht“-Gesängen zu tun, die mir nicht unbekannt waren – im Frühling zuvor hatte ich, dasselbige singend, versucht, beim Hexentanz in Frau Martins Garten den Kirschbaum abzufackeln, an den ich vorher mit Hilfe ihrer Tochter Bettina die andere Tochter Vreni gefesselt hatte.
Das also war es nicht, was uns in der hochaufragenden Kirche erwartete. Über eine Treppe ging es hinauf, dann öffnete sich das Tor, ich ging hinein – und der Sommer war vorbei. Kühl und modrig war es in dem Gemäuer, durch die kleinen Fenster fiel wenig Licht auf die fast schwarzen Wände. Beim genaueren Hinsehen entpuppte sich die Wandfarbe als endlose Fläche von kleinen, dunklen Bildern, auf denen Menschen mit allen möglichen Gebrechen zu sehen waren. Da wurde geschossen, Knochen entzweiht und vom Wagen gefallen, da stürzten Menschen in Schluchten, und alle waren sie unsagbar hässlich, grob gemalt und voller grausamer Details. Wo keine Bilder hingen, waren abnorme Krücken an die Wand genagelt, oder auch Ketten, Handschellen und Halseisen. Das alles, erklärte uns Frau D., seien die Gaben von Leuten, die die heilige Walburga geheilt hatte, auch das da in dem Kasten – und sie wies auf die rechte Wand, wo ein roter Fleck unter all dem Schwarz hervorstach. Wir gingen hinüber. Der rote Fleck erwies sich als mit Samt ausgeschlagener Schaukasten, in dem Knochensplitter, Kugeln, Magensteine, böse Zähne und viele andere Körperteile ausgestellt waren. Ein Magenstein, so gross wie eine Faust, hatte die Form eines Herzens, ein aschfahles, pickliges Herz in einer schwarz angelaufenen Silberfassung. Die Zähne waren braun, abgekaut, zerborsten oder lange, schiefe Missbildung, manchmal noch mit Kochensplittern daran. Menschentrümmer in allen Varianten, zackig, geborsten, morsch und faulig. Was immer in den diversen Glasampullen war – Eiter, Ausfluss, Blut – es war dunkel-klebrig eingetrocknet und verharzt. Frau D. erklärte, welch grosses Leid den Menschen genommen worden war, ich hingegen begann, dasselbige inzwischen im Magen zu verspüren, in den tiefsten Eingeweiden, die seit dem Frühstück auf Knödel, goldgelbe saftige Knödel warteten, und nun vom Anblick dieser Trümmer gepeinigt und aufgewühlt wurden. Jürgen, die Strebersau, und auch einige andere knieten sich auf Frau D.s Kommando hin und sagten ein Gebet auf, während ich mich in Richtung Ausgang drückte. Doch der erwies sich als vom Pfarrer K. blockiert.
Und etzad gemma nunta, sagte der Stadtpfarrer, und wies mir und den Nachfolgenden den Weg eine Treppe hinab in das Erdreich unter diesem schwarzen Saal. Es öffnete sich ein kleiner Raum, wo wir eng zusammengedrängt an einem Gitter standen. Dahinter leuchtete fahl ein grosser, weisser, rechteckiger Streinsarg – und in dem, so erklärte uns der nachgekeuchte Stadtpfarrer, befinde sich die Wallburga, die all die Wunder mache. Und das geht so: Zu einer gewissen Zeit im Frühjahr tropft aus diesem Sarg, in dem Wallburga liegt, ein Öl, das die Nonnen hier auffangen. Das Öl wirkt Wunder, heilt und segnet alles, was damit in Berührung kommt, und wir alle werden dadurch gesegnet. Jetzt. Gleich. Und auf der anderen Seite, über eine zweite Treppe, kam eine finstere Gestalt herunter, über und über schwarz, mit einem Kästchen in der Hand, und trat auf uns zu. Es war eine hässliche, verschrumpelte alte Frau in diesem dunklen, stinkenden Loch unter der Erde, neben uns lag diese Leiche in ihrem Sarg und badete in diesem Verwesungsöl aus ihrem Körper, ich konnte es riechen, dieses saftige, stinkende, schwarz aufgedunsene Kadaver mit wirren Haaren, borstig und abstossend wie das Gewächs aus des Stadtpfarrers Nase, und der gleiche verfaulte Saft war in den Ampullen, die im Kästchen auf uns warteten. Der K. postierte sich neben ihr, zwei alte Fleischklumpen in der Finsternis, und hinter uns machte Frau D. die Räume dicht. Das erste Kind musste vortreten, der Pfarrer tauchte seine Pranke in eine Schale mit diesem Leichenöl, streckte, murmelnd, die Hand aus und machte ein Kreuz auf dessen Stirn. Das Kind musste eine Ampulle nehmen, die schwarze Krähe steckte die Hand aus, um eine Gabe zu nehmen. Es war nicht der Gedanke, dass ich da auch zahlen müsste und deshalb nachher in der Linde einen oder zwei Knödel weniger essen könnte, es war auch nicht die lange Reihe meiner Mitschüler, die sich wie willenlose Zombies für das Ritual einreihten, hier unter der Erde, mit den schwarzen Bildern, den Nierensteinen über und der in Öl eingelegten Wallburga neben uns, es war nicht der K. und das Ritual und auch nicht die massige Figur der D. in dieser Szene – letztlich war es Jürgen, der Schlumpfbildbescheisser, der sich zu mir umdrehte, meine Panik erkannte und sagte: Du bekommst kein Kreuz, du musst das Öl trinken, und meines bekommst Du auch.
Ich drehte mich um, presste mich am Fleischberg von Frau D. vorbei, der ins Wanken geriet, raste die Treppe hoch und rannte, ohne noch einen Blick auf die schwarzen Tafeln, die Gallensteine und Krücken zu werfen, auf die Tür zu, wo ich in eine Gruppe Touristen knallte, an ihnen vornbei hinein in das gleissende Licht, in den unfassbar schönen Sommer, in die klare, reine Luft des Jura, von Helligkeit durchdrungen und gereinigt von all der Verwesung, die mich zu umfangen drohte, unendlich weit weg vom K., der schwarzen Frau und dem Kadaver im fahlen Stein und seinem schleimigen Öl, das meiner im Bauch der Erde harrte.
Kurz darauf war das jüdische Neujahrsfest Rosch ha Schana, an dessen Ende es zu Jom Kippur Geschenke für die Kinder gibt. Meine Mutter war sehr zufrieden mit ihrem mathematisch interessierten Sohn, der von den bislang gewünschten Ritterfiguren Abstand nahm und ein 35 Zentimeter langes, spitzwinkliges Geodreieck haben wollte, lang genug, um notfalls auch einen fetten Stadtpfarrer zu erstechen, falls er ihm mit dem Saft der Wallburga zu nahe kam.
donalphons, 15:49h
... link (17 Kommentare) ... comment
... older stories