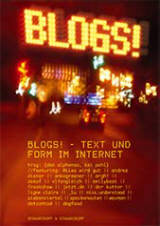... newer stories
Montag, 9. Juni 2008
Die Rettung des Raben Teil 1
ich verstehe, dass manche mich nicht verstehen: Ein Kilo Erdbeeren kostet draussen im Feld 1,70 Euro, imVergleich zu 4 Euro beim Gemüsehändler. Und ich bin nicht so versessen darauf, dass ich in diesem Sommer mehr als 10 Kilo bräuchte. Macht also 23 Euro Gewinn, wenn wir den Genuss des Selberpflückens und die Auswahl der Schönsten gegen den Zeitverlust rechnen. Dazu kommen noch 10 Kilo Zwetschgen von Wegesrändern im Spätsommer, womit ich - unter gleichen Bedingungen - 30 Euro spare. 40 Euro nun hat der blaue Rabe gekostet, mit dem ich diese Touren unternehmen möchte. Das wären dann 13 Euro Gewinn, wenn ich nicht schon ein paar Räder hätte. Und wäre da nicht die Arbeitszeit, die ich in das praktisch fahruntüchtige Stück deutscher Wirtschaftswundergeschichte stecke. Sagen wir grob: 15 Stunden. Würde ich diese Zeit nehmen und darin kluge Sachen über den grauen Kapitalmarkt schreiben, und einmal Haifische zu einer Gesellschafterversammlung fahren, würde ich auch nach Steuern genug Geld haben, um mich an Erdbeeren und Zwetschgen mit Lieferservice totzufressen. Aber.

Da ist einmal der Arbeitsplatz. Auch das werden manche vielleicht nicht verstehen, aber es ist allein schon befriedigend, hier oben zu sitzen, etwas zu polieren und dabei diesen Ausblick zu haben. Man kann das nicht aufrechnen, das ist so idiotisch wie Blogleser in Tausenderkontaktpreisen zu verhökern. Diese Stunden sind nicht irgendwas, sie stehen für sich selbst, sie sind. Und ich lerne dabei. Ich lerne etwas über Licht am Fahrrad; ein Thema, das bislang immer nur im Zusammenhang mit dem Verb "wegschrauben" auftauchte. Normalerweise halte ich am Rad Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, Licht und überhaupt alles, was nicht direkt dem Fahren, Lenken und Bremsen dient, für überflüssiges Gewicht. Entsprechend puristisch sieht dann auch der restliche, erdbeeruntaugliche Fuhrpark aus. Einen Moment habe ich natürlich auch überlegt, den Raben radikal bis auf die Schutzbleche zu strippen, aber das wäre eine Schande. Statt dessen lasse ich ihn so original wie möglich. Denn jedes Teil erzählt Geschichte.

Wie dieser Bosch-Dynamo. Das fängt schon beim Typenschild an, das auf französisch verkündet: "Importe d´Allemagne". Möglicherweise noch eine Spätfolge der Besatzung Südwestdeutschlands durch die Franzosen nach dem zweiten Weltkrieg; ein West vor dem Germany fehlt noch. Vielleicht kommt auch das Material vom Krieg: Denn der Dynamo ist aus Aluminium, das damals in grossen Mengen zur Verfügung stand. Die Besatzer verschrotteten nicht nur die deutsche Luftwaffe, sondern auch ihre eigenen, im Düsenzeitalter mittlerweise obsolet gewordenen Propellermaschinen. Bosch baute mit seinem RL/WQ2 eine Lichtmaschine für die Ewigkeit: 4 Spulen, 4 Anker, kein einziges Teil, das nicht aus Metall ist, komplett zerlegbar und oben mit einer Schraube versehen, um das Gleitlager - noch so eine Eigenheit des zweiten Weltkriegs, besonders unter Rüstungsminister Albert Speer wurde die Nazi-Wirtschaft angewiesen, möglichst wenig Kugellager zu verwenden, nachdem die Alliierten gezielt die Kugellagerfabriken bombardiert hatten - zu ölen. Der Dynamo ist nicht leicht, aber er ist nach 56 Jahren wie neu und dreht sich vermutlich noch, wenn all die modernen Entsprechungen aus Taiwan mitsamt der daran hängenden Räder schon verschrottet sind. Weil die Konstrukteure in Produktzyklen dachten, die heute mit den jährlich in Modefarben produzierten Rädern unvorstellbar sind. Und daran, dass die Kunden dauerhaft besitzen und nicht nur mit einem billigen Trumm das Recht zum jährlichen Werkstattbesuch leasen wollten. Wer sowas wegmacht, zieht vermutlich auch nach Berlin, testet für Geld Opel Astra, macht sich mit seinem Gestotter für Zoomer und Watchberlin zum Deppen, wirbt für die Büttel chinesischer Mörder, und würde mit dem Bericht über den Kapitalmarkt hudeln, um dann zum pablik viuing zu gehen.
Man kann natürlich so rechnen. Ich nenne es die Rechnung der armen Schweine.

Da ist einmal der Arbeitsplatz. Auch das werden manche vielleicht nicht verstehen, aber es ist allein schon befriedigend, hier oben zu sitzen, etwas zu polieren und dabei diesen Ausblick zu haben. Man kann das nicht aufrechnen, das ist so idiotisch wie Blogleser in Tausenderkontaktpreisen zu verhökern. Diese Stunden sind nicht irgendwas, sie stehen für sich selbst, sie sind. Und ich lerne dabei. Ich lerne etwas über Licht am Fahrrad; ein Thema, das bislang immer nur im Zusammenhang mit dem Verb "wegschrauben" auftauchte. Normalerweise halte ich am Rad Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, Licht und überhaupt alles, was nicht direkt dem Fahren, Lenken und Bremsen dient, für überflüssiges Gewicht. Entsprechend puristisch sieht dann auch der restliche, erdbeeruntaugliche Fuhrpark aus. Einen Moment habe ich natürlich auch überlegt, den Raben radikal bis auf die Schutzbleche zu strippen, aber das wäre eine Schande. Statt dessen lasse ich ihn so original wie möglich. Denn jedes Teil erzählt Geschichte.

Wie dieser Bosch-Dynamo. Das fängt schon beim Typenschild an, das auf französisch verkündet: "Importe d´Allemagne". Möglicherweise noch eine Spätfolge der Besatzung Südwestdeutschlands durch die Franzosen nach dem zweiten Weltkrieg; ein West vor dem Germany fehlt noch. Vielleicht kommt auch das Material vom Krieg: Denn der Dynamo ist aus Aluminium, das damals in grossen Mengen zur Verfügung stand. Die Besatzer verschrotteten nicht nur die deutsche Luftwaffe, sondern auch ihre eigenen, im Düsenzeitalter mittlerweise obsolet gewordenen Propellermaschinen. Bosch baute mit seinem RL/WQ2 eine Lichtmaschine für die Ewigkeit: 4 Spulen, 4 Anker, kein einziges Teil, das nicht aus Metall ist, komplett zerlegbar und oben mit einer Schraube versehen, um das Gleitlager - noch so eine Eigenheit des zweiten Weltkriegs, besonders unter Rüstungsminister Albert Speer wurde die Nazi-Wirtschaft angewiesen, möglichst wenig Kugellager zu verwenden, nachdem die Alliierten gezielt die Kugellagerfabriken bombardiert hatten - zu ölen. Der Dynamo ist nicht leicht, aber er ist nach 56 Jahren wie neu und dreht sich vermutlich noch, wenn all die modernen Entsprechungen aus Taiwan mitsamt der daran hängenden Räder schon verschrottet sind. Weil die Konstrukteure in Produktzyklen dachten, die heute mit den jährlich in Modefarben produzierten Rädern unvorstellbar sind. Und daran, dass die Kunden dauerhaft besitzen und nicht nur mit einem billigen Trumm das Recht zum jährlichen Werkstattbesuch leasen wollten. Wer sowas wegmacht, zieht vermutlich auch nach Berlin, testet für Geld Opel Astra, macht sich mit seinem Gestotter für Zoomer und Watchberlin zum Deppen, wirbt für die Büttel chinesischer Mörder, und würde mit dem Bericht über den Kapitalmarkt hudeln, um dann zum pablik viuing zu gehen.
Man kann natürlich so rechnen. Ich nenne es die Rechnung der armen Schweine.
donalphons, 01:49h
... link (8 Kommentare) ... comment
Eine Frage des Stils
Ein Kauf war gut, wenn man auf dem Weg vom Flohmarkt zum Auto angesprochen wird, ob man es nicht verkaufen möchte. Manche erkennen es erst, wenn ein anderer es fortträgt, wenn es befreit ist, von der manchmal skurrilen oder gar bedauerlichen Umgebung, aber dann begreifen sie. Heute ist mir das fünf mal passiert, zweimal in München und dreimal beim photographieren daheim. Ich werde ein Schloss brauchen.
Um Stil zu begreifen, sollte man keinesfalls Berliner Modeblogs anschauen, oder Hochglanzzeitschriften, oder amerikanische Serien. Stil hat ein Zuhause, und es befindet sich ziemlich genau unter den Sonnenschirmen der Bar Venezia inmitten der Altstadt von Mantua, von wo aus die Arkaden ihren Anfang nehmen. Dort setzt man sich hin, bestellt einen Eistee und schaut zu, was da kommt. Es kommt vieles, es kommt oft mit dem Rad, und machmal ist es besser als jede Modenschau.

Das Mysterium besteht darin, dass es nur Alltag und dennoch wie ein inszeniertes Theater, und dass sie nicht so verkleidet sind, sondern es einfach leben. Während man in München jederzeit damit rechnen muss, von einem blankkeputzten Mountainbike plattgewalzt zu werden, geht es hier langsam zu, und die Leute schaffen diesen Stil vollkommen problemlos mit dem alten Hollandrad von Oma. Gerade mit diesen Rädern. Während die meisten Fiat 500, Lancia Aprilia und Alfa Giulias in ihren Bonbonfarben, dem celeste, dem rosso und biancho längst von den Schrottpressen zerdrückt wurden, haben sich viele alte Räder von Bianchi, Legnano und Battaglin in Quietschbunt über die Jahrzehnte gerettet und tragen heute noch dazu bei, dass Italiens Innenstädte ruhig und voller schöner, nicht zu schneller Menschen sind.
Das schmerzt natürlich. Weil man in Deutschland weder diese Ruhe, noch diesen Stil und natürlich auch nicht diese Räder in diesen Farben hat. Omaräder gibt es in Schwarz, Schwarz mit weissen Streifen und Schwarz mit grauen Streifen. Wenn überhaupt. In Deutschland versteht man sich vor allem auf das Wegwerfen. Und würde man nicht ohnehin schon leiden, kommt dann noch ein Herr und stellt einem das hier vor die Nase:

Das ist nicht nett. Das tut weh. Noch schlimmer als das Celeste-Blau, das der Kundige auch als Bugatti-Blau kennt und schätzt, noch schlimmer als all das Leder und das Täschchen hinten ist das Wissen, dass es zu diesen Repliken auch Originale gibt. Man kommt in Versuchung, sich so etwas zu, nun, sagen wir mal borgen, aber ich habe natürlich "Ladri di biciclette" von Vittorio de Sica gesehen, ich kenne das neorealistische Ende und würde dergleichen nicht tun. Die Copilotin hatt dagegen so ein unheilvollen Zucken in der Hand, und am Ende standen wir in Salurn und versuchten, einem Händler ein ähnliches, originales Exemplar abzuschwatzen, das leider nur zur Reparatur dort stand. Die Bemühung ist um so verständlicher, als das radeln mit einem für mich Rennradpiloten ungewöhnten 1-Gang-Rad mit Körberl und quietschendem Sattel neu, aber auch sehr spassig war. Ja, auch ich muss zugeben: Für kleinere Strecken, zum See oder zu den Erdbeeren, wäre so ein himmelblaues Herrenrad mit Chrom ganz wunderbar, man müsste es nur finden und über die Pässe bringen. Denn in Deutschland gibt es solche Räder nicht.
Ausser im Keller eines mittelalten türkischen Herren, der ein Rabeneick Modell 59 von 1952 von seinem Schwiegervater geerbt hat, wo es nun schon Jahrzehnte vor sich hingammelte, und nun endlich raus sollte. Er hatte keinen Platz mehr, also ab damit auf den Flohmarkt.

Es kommt zwar nur aus Bielefeld, aber es ist in diesem wunderbar optimistischen Strand- und Wirtschaftswunderblau, mit weiss und vielen verchromten Details, rostig, aber bis auf den Satten und die Reifen original, mit Heckflossenornamenten am Sportschutzblech und Schnellspannschrauben mit Firmenlogo. Mit grau marmorlierten Bakelitgriffen und einem gigantischen Bosch-Scheinwerfer, der auch noch geht. Mit verchromtem Werkzeugkastendeckel und Schutzblechen, die den Namen verdienen. Dieses Rad stand einen halben Tag am Stand herum, keiner wollte es haben, und als ich es dann für - nun wirklich läppische 40 Euro - gekauft hatte, begannen die Fragen. Woher, was kostet, sie würden mir auch 50. Und so weiter. Was fehlt, sind Weisswandreifen, ein neuer Ledersattel - beides daheim im Fundus - und eine ordentliche Putz- und Poliereinheit, sowie neue Bremsgummis.

Ich stand heute morgen vor dem Flohmarktbesuch auch vor einem Bitter CD, einem dem Ferrari 400 nachempfundenen Sportwagen auf Opelbasis, den mir jemand vermitteln wollte. Vielleicht das letzte hübsche Auto, das jemals mit dem Namen Opel in Verbindung zu bringen war. Er wäre gar nicht teuer gewesen, ich hätte auch ein paar Parkplätze am Tegernsee, aber 20 Liter auf 100 Kilometer ist dann doch etwas zu viel, und brauche ich einen geschlossenen Zweitwagen?
Zumal, wenn ich so ein Rad habe. Detailphotos im Kommentar.
Um Stil zu begreifen, sollte man keinesfalls Berliner Modeblogs anschauen, oder Hochglanzzeitschriften, oder amerikanische Serien. Stil hat ein Zuhause, und es befindet sich ziemlich genau unter den Sonnenschirmen der Bar Venezia inmitten der Altstadt von Mantua, von wo aus die Arkaden ihren Anfang nehmen. Dort setzt man sich hin, bestellt einen Eistee und schaut zu, was da kommt. Es kommt vieles, es kommt oft mit dem Rad, und machmal ist es besser als jede Modenschau.

Das Mysterium besteht darin, dass es nur Alltag und dennoch wie ein inszeniertes Theater, und dass sie nicht so verkleidet sind, sondern es einfach leben. Während man in München jederzeit damit rechnen muss, von einem blankkeputzten Mountainbike plattgewalzt zu werden, geht es hier langsam zu, und die Leute schaffen diesen Stil vollkommen problemlos mit dem alten Hollandrad von Oma. Gerade mit diesen Rädern. Während die meisten Fiat 500, Lancia Aprilia und Alfa Giulias in ihren Bonbonfarben, dem celeste, dem rosso und biancho längst von den Schrottpressen zerdrückt wurden, haben sich viele alte Räder von Bianchi, Legnano und Battaglin in Quietschbunt über die Jahrzehnte gerettet und tragen heute noch dazu bei, dass Italiens Innenstädte ruhig und voller schöner, nicht zu schneller Menschen sind.
Das schmerzt natürlich. Weil man in Deutschland weder diese Ruhe, noch diesen Stil und natürlich auch nicht diese Räder in diesen Farben hat. Omaräder gibt es in Schwarz, Schwarz mit weissen Streifen und Schwarz mit grauen Streifen. Wenn überhaupt. In Deutschland versteht man sich vor allem auf das Wegwerfen. Und würde man nicht ohnehin schon leiden, kommt dann noch ein Herr und stellt einem das hier vor die Nase:

Das ist nicht nett. Das tut weh. Noch schlimmer als das Celeste-Blau, das der Kundige auch als Bugatti-Blau kennt und schätzt, noch schlimmer als all das Leder und das Täschchen hinten ist das Wissen, dass es zu diesen Repliken auch Originale gibt. Man kommt in Versuchung, sich so etwas zu, nun, sagen wir mal borgen, aber ich habe natürlich "Ladri di biciclette" von Vittorio de Sica gesehen, ich kenne das neorealistische Ende und würde dergleichen nicht tun. Die Copilotin hatt dagegen so ein unheilvollen Zucken in der Hand, und am Ende standen wir in Salurn und versuchten, einem Händler ein ähnliches, originales Exemplar abzuschwatzen, das leider nur zur Reparatur dort stand. Die Bemühung ist um so verständlicher, als das radeln mit einem für mich Rennradpiloten ungewöhnten 1-Gang-Rad mit Körberl und quietschendem Sattel neu, aber auch sehr spassig war. Ja, auch ich muss zugeben: Für kleinere Strecken, zum See oder zu den Erdbeeren, wäre so ein himmelblaues Herrenrad mit Chrom ganz wunderbar, man müsste es nur finden und über die Pässe bringen. Denn in Deutschland gibt es solche Räder nicht.
Ausser im Keller eines mittelalten türkischen Herren, der ein Rabeneick Modell 59 von 1952 von seinem Schwiegervater geerbt hat, wo es nun schon Jahrzehnte vor sich hingammelte, und nun endlich raus sollte. Er hatte keinen Platz mehr, also ab damit auf den Flohmarkt.

Es kommt zwar nur aus Bielefeld, aber es ist in diesem wunderbar optimistischen Strand- und Wirtschaftswunderblau, mit weiss und vielen verchromten Details, rostig, aber bis auf den Satten und die Reifen original, mit Heckflossenornamenten am Sportschutzblech und Schnellspannschrauben mit Firmenlogo. Mit grau marmorlierten Bakelitgriffen und einem gigantischen Bosch-Scheinwerfer, der auch noch geht. Mit verchromtem Werkzeugkastendeckel und Schutzblechen, die den Namen verdienen. Dieses Rad stand einen halben Tag am Stand herum, keiner wollte es haben, und als ich es dann für - nun wirklich läppische 40 Euro - gekauft hatte, begannen die Fragen. Woher, was kostet, sie würden mir auch 50. Und so weiter. Was fehlt, sind Weisswandreifen, ein neuer Ledersattel - beides daheim im Fundus - und eine ordentliche Putz- und Poliereinheit, sowie neue Bremsgummis.

Ich stand heute morgen vor dem Flohmarktbesuch auch vor einem Bitter CD, einem dem Ferrari 400 nachempfundenen Sportwagen auf Opelbasis, den mir jemand vermitteln wollte. Vielleicht das letzte hübsche Auto, das jemals mit dem Namen Opel in Verbindung zu bringen war. Er wäre gar nicht teuer gewesen, ich hätte auch ein paar Parkplätze am Tegernsee, aber 20 Liter auf 100 Kilometer ist dann doch etwas zu viel, und brauche ich einen geschlossenen Zweitwagen?
Zumal, wenn ich so ein Rad habe. Detailphotos im Kommentar.
donalphons, 17:36h
... link (31 Kommentare) ... comment
... older stories