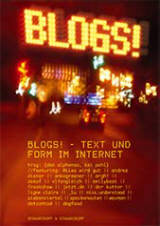Ich nannte ihn Peter
Er hiess anders. Und war auch kein Versager, wie ich ihn geschildert habe. Er war nicht allzu gut, nicht Elite, aber das war damals egal. Da konnte auch einer CEO werden, der jetzt für eine Schweizer Luftlinie rumjettet und versucht, auf Credibility zu machen. Oder Leute wie ich Berater. Anything goes. Sagen wir, Peter war guter Durchschnitt. Bevor er im Buch stirbt, denkt er noch einmal darüber nach, nach Italien zu fahren, alles hinter sich zu lassen, zu vergessen, aber das lässt man natürlich nicht zu. Wäre er gefahren, dann wäre er sicher auch nach Gargnano gekommen. Peter war ein Gardesana Occidentale Typ, die Westseite des Sees hat einfach mehr Kultur, und Gargnano wäre mit der Villa Feltrinelli sein Standort gewesen, von dem aus er den Palazzo Bettoni besucht hätte. Wenn man lange mit Leuten zusammen ist, überlegt man sich schon, was sie sich geacht haben, bevor sie gestorben sind. Der Friedhof von Gargnano hätte ihm sicher auch gefallen, hier liegen die, zu deren Schicht er gern gehört hätte.

Für die Ziele, für die Vorstellungen von dem, was da kommen mag in diesem Job, sind die Begräbnisse von Beratern schockierend banal. Wenn sich abzeichnet, dass es mit einem Probleme gibt, wenn er nicht mehr die Leistung bringt oder sonstwie aus dem Laden ausschert, wenn er nicht mehr voll dahinter steht oder man ihm den Leader nicht mehr abnimmt, wenn er also innerlich als Berater schon tot ist, dann versucht man eben, ihn rechtzeitig rauszukegeln, Grow or Go ist die Devise. Wenn er draussen stirbt, ist alles paletti, dann ist es nur was für seine verbliebenen Freunde. Nichts von wegen Massenauflauf des Netzwerks, ein paar Versprengte nur, die so irgendwie gar nicht zu den Schulfreunden passen, die auch kommen, weil man in der Kleinstadt eben kommt. Auch wenn er ihnen entfremdet war, weil er keine Zeit mehr hatte und schon vorher mit seinen Träumen von der Kunstgeschichte aneckte.

Über die Stufen hinauf zur Kapelle kommt man an den Gesichtern der Verstorbenen vorbei, noch so eine italienisch-französische Eigenart, die in Deutschland nicht in Frage kommen würde. Da steckt man ein Holzkreuz rein, irgendwann kommt unten, wo noch Platz ist, der Name auf den familiären Grabstein. Für die ehemaligen Kollegen ist sowas eine Erleichterung, weil man, wenn man ehrlich war, beim letzten Absturz aus der Sphäre der Begünstigten auch schon weggeschaut hat, oder versuchte, die Position zu sichern. Mit den Photos aus der Zeit hat es sowieso eine seltsame Bewandtnis. Alle lächeln freundlich, fast wie bei den archaischen Staaten des Tempels von Cap Sunion, wo auch die Gefallenen und Sterbenden dieses Lächeln tragen. Eine andere Regung, ein echtes Lachen gab es nicht, zumindest nicht auf den Bildern, nur in der Erinnerung.

Für die, die aus der grossen Stadt kommen, ist sowas immer ein Einschnitt. Gestorben wird in der Munich Area, man ist zum Begräbnis aber oft drei, vier Stunden unterwegs, und kann nachdenken, warum es ihn erwischt hat und nicht einen selber. Wenn es nicht das erste Mal ist, oder kurz nacheinander passiert, wird das fest gefügte Leben schnell eine flüssige Masse, die einen zu ersticken droht, selbst wenn es keine engen Freunde waren. Warum warum warum, aber vielleicht ist es ja bald soweit, vielleicht waren sie nur die early birds, der Beginn eines Trends, und wenn man sich zwei Wochen später schon wieder zu so einem Anlass trifft, ist die Frage eher: Wer ist der nächste?

Hinter der Kapelle sind die Gräber der Alpini aus dem ersten Weltkrieg. Die Front war nicht weit weg, hier waren die Lazarette, hier sind sie gestorben wie die Fliegen, ohne Kugel, Kälte oder Bajonettstich. Dass jemand mal draufgeht in einer Nacht, wegen einer Überdosis und dem falschen Zeug, ist irgendwo nachvollziehbar, wenn der Stress alles aus ihnen rausgesaugt hat und etwas am Kippen war. Dann macht man eben Fehler in der Bilanz, in der Berechnung oder in der Dosis. Vielleicht ist es auch ein Selbstmord, aber wenn, dann ist er irgendwo zwischen Vorsatz, Existenzangst und Nachlässigkeit festgefroren, ich kenne jedenfalls keinen, der einen Abschiedsbrief hinterlassen hätte. Auch nicht, wenn alles schon vorbei war und sie sich neu hätten orientieren können. Eine Chance gibt es immer, aber im Krieg tötet der Fatalismus und die Selbstaufgabe mehr Menschen als Kugeln. Sagt man.

Dass es so weit weg ist, hat andererseits den Vorteil, dass man vergessen kann. Man muss nicht jedesmal am Nordfriedhof vorbei, was ja keine schlechte Erinnerung ist, hier verschimmelt schliesslich die Drecksau, die einen Teil der Schuld hat, und die anderen Schweine werden es auch nicht mehr lange machen, so wie sie jetzt schon vegetieren. Es ist eine Gnade, diese Zeit manchmal vergessen zu dürfen, es wegschieben zu können, wenn die Erinnerung verblasst, besonders, wenn man gut schläft und lebt, dann wird es weniger, vielleicht ist es irgendwann ganz vorbei, es gibt nichts, was nicht versucht wurde, schreiben, reden, ablenken, rekapitulieren, bis die Erinnerung ausfranst.

Aber immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet, in ganz anderem Zusammenhang und ohne Anlass, ist es wieder da, es beisst sich in das Bewusstsein, als wäre es gestern gewesen, als würde man nie geschlafen haben nach dem elenden Warten auf dem Gang, bis das Ende am Morgen kommt. Es wäre vielleicht einfacher, wenn man wüsste, dass er das eine Mal, das er beim Sterben hatte, es zumindest diesmal hierher geschafft hätte, unter die Zypressen am See und den Blick hinaus in den weissen, hellen Dunst.


Für die Ziele, für die Vorstellungen von dem, was da kommen mag in diesem Job, sind die Begräbnisse von Beratern schockierend banal. Wenn sich abzeichnet, dass es mit einem Probleme gibt, wenn er nicht mehr die Leistung bringt oder sonstwie aus dem Laden ausschert, wenn er nicht mehr voll dahinter steht oder man ihm den Leader nicht mehr abnimmt, wenn er also innerlich als Berater schon tot ist, dann versucht man eben, ihn rechtzeitig rauszukegeln, Grow or Go ist die Devise. Wenn er draussen stirbt, ist alles paletti, dann ist es nur was für seine verbliebenen Freunde. Nichts von wegen Massenauflauf des Netzwerks, ein paar Versprengte nur, die so irgendwie gar nicht zu den Schulfreunden passen, die auch kommen, weil man in der Kleinstadt eben kommt. Auch wenn er ihnen entfremdet war, weil er keine Zeit mehr hatte und schon vorher mit seinen Träumen von der Kunstgeschichte aneckte.

Über die Stufen hinauf zur Kapelle kommt man an den Gesichtern der Verstorbenen vorbei, noch so eine italienisch-französische Eigenart, die in Deutschland nicht in Frage kommen würde. Da steckt man ein Holzkreuz rein, irgendwann kommt unten, wo noch Platz ist, der Name auf den familiären Grabstein. Für die ehemaligen Kollegen ist sowas eine Erleichterung, weil man, wenn man ehrlich war, beim letzten Absturz aus der Sphäre der Begünstigten auch schon weggeschaut hat, oder versuchte, die Position zu sichern. Mit den Photos aus der Zeit hat es sowieso eine seltsame Bewandtnis. Alle lächeln freundlich, fast wie bei den archaischen Staaten des Tempels von Cap Sunion, wo auch die Gefallenen und Sterbenden dieses Lächeln tragen. Eine andere Regung, ein echtes Lachen gab es nicht, zumindest nicht auf den Bildern, nur in der Erinnerung.

Für die, die aus der grossen Stadt kommen, ist sowas immer ein Einschnitt. Gestorben wird in der Munich Area, man ist zum Begräbnis aber oft drei, vier Stunden unterwegs, und kann nachdenken, warum es ihn erwischt hat und nicht einen selber. Wenn es nicht das erste Mal ist, oder kurz nacheinander passiert, wird das fest gefügte Leben schnell eine flüssige Masse, die einen zu ersticken droht, selbst wenn es keine engen Freunde waren. Warum warum warum, aber vielleicht ist es ja bald soweit, vielleicht waren sie nur die early birds, der Beginn eines Trends, und wenn man sich zwei Wochen später schon wieder zu so einem Anlass trifft, ist die Frage eher: Wer ist der nächste?

Hinter der Kapelle sind die Gräber der Alpini aus dem ersten Weltkrieg. Die Front war nicht weit weg, hier waren die Lazarette, hier sind sie gestorben wie die Fliegen, ohne Kugel, Kälte oder Bajonettstich. Dass jemand mal draufgeht in einer Nacht, wegen einer Überdosis und dem falschen Zeug, ist irgendwo nachvollziehbar, wenn der Stress alles aus ihnen rausgesaugt hat und etwas am Kippen war. Dann macht man eben Fehler in der Bilanz, in der Berechnung oder in der Dosis. Vielleicht ist es auch ein Selbstmord, aber wenn, dann ist er irgendwo zwischen Vorsatz, Existenzangst und Nachlässigkeit festgefroren, ich kenne jedenfalls keinen, der einen Abschiedsbrief hinterlassen hätte. Auch nicht, wenn alles schon vorbei war und sie sich neu hätten orientieren können. Eine Chance gibt es immer, aber im Krieg tötet der Fatalismus und die Selbstaufgabe mehr Menschen als Kugeln. Sagt man.

Dass es so weit weg ist, hat andererseits den Vorteil, dass man vergessen kann. Man muss nicht jedesmal am Nordfriedhof vorbei, was ja keine schlechte Erinnerung ist, hier verschimmelt schliesslich die Drecksau, die einen Teil der Schuld hat, und die anderen Schweine werden es auch nicht mehr lange machen, so wie sie jetzt schon vegetieren. Es ist eine Gnade, diese Zeit manchmal vergessen zu dürfen, es wegschieben zu können, wenn die Erinnerung verblasst, besonders, wenn man gut schläft und lebt, dann wird es weniger, vielleicht ist es irgendwann ganz vorbei, es gibt nichts, was nicht versucht wurde, schreiben, reden, ablenken, rekapitulieren, bis die Erinnerung ausfranst.

Aber immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet, in ganz anderem Zusammenhang und ohne Anlass, ist es wieder da, es beisst sich in das Bewusstsein, als wäre es gestern gewesen, als würde man nie geschlafen haben nach dem elenden Warten auf dem Gang, bis das Ende am Morgen kommt. Es wäre vielleicht einfacher, wenn man wüsste, dass er das eine Mal, das er beim Sterben hatte, es zumindest diesmal hierher geschafft hätte, unter die Zypressen am See und den Blick hinaus in den weissen, hellen Dunst.

donalphons, 01:00h
Dienstag, 23. Mai 2006, 01:00, von donalphons |