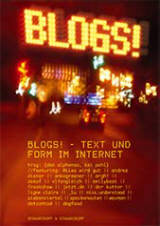Grandmother´s Finest
In der Küche stehen die Beweise dafür, dass ich in meiner Saison en Enfer, meiner Zeit in der Unterwelt Berlins, die heute weitgehend im Dunkel des Vergessens verschwunden ist bis auf die lieben Menschen, die ich dort kennen dürfte; in der Küche also stehen die Beweise, dass ich dort noch etwas anderes getan habe, als auf den Schmutz zu starren und dafür die dortige verlorene Pracht zu verachten. In meiner freien Zeit habe ich viel gejagt und auch manches gefunden, und was davon heute in der neuen Wohnung ist, steht nun zumeist im Küchenschrank. Und nicht, wie die alten Stücke der Familie, in der Biedermeiervitrine neben den historischen Büchern im Wohnzimmer.
Und wenn ich jetzt alles hergeben müsste und nur eine Sache da drin behalten dürfte, unter all den in Kälte, Eis und Hitze den Händlern entrissenen Schätzen, den englichen Teekannen, den Biedermeierschalen, den amerikanischen Streuern, den weniger wertvollen, versilberten Tabletts, die zur Hochzeit verschenkt wurden und den Gläsern der Witwe Loetz -

dann würde ich das alles hergeben und lediglich die weissblaue Borte behalten. Denn mit der hat es, wie überhaupt dem Küchenschrank, eine besondere Bewandtnis.
Früher war es in dieser Stadt so, dass man innerhalb der Stadtmauern wohnte. Wer hier zu den besseren Kreisen gehörte, war meist auch Mitglied eines der Schützenvereine, oder, wenn es die rund 1000 Personen umfassenden Clans der Oberschicht betraf, Mitglied im Jagdverein. Darunter kamen dann, für die Bewohner der schlechteren Viertel, die Reservistenvereine. Aber die meisten Männer hatten zuhause irgendeinen Schiessprügel. Der verlangte nach Aufmerksamkeit und Übung. Und dafür gab es in den Donauaauen einen Schiessplatz, wo man sich am Samstag und Sonntag zum Ballern traf.
Der Schiessplatz wiederum lag in der sumpfigen, unfruchtbaren Donauniederung westlich der Altstadt, jenseits der Stadtbefestigung. Man baute eine schnurgerade Strasse hinaus, dazu noch ein Schützenhäuschen, später eine Gaststätte, und dort war dann stets geselliges Treiben: Die Männer schossen, die Kinder spielten, und die Frauen tratschten, wer mit wem im Bett war und welches Kind ein Bastard sein möge. Immer wieder unterbrochen durch den lauten Knall der Büchsen und Jagdflinten.
Damals waren die Damen auch noch etwas empfindsamer als ihre heutigen Nachfahrinnen, die von der Glotze ganz andere Ballereien beim Chipsfressen gewöhnt sind, und so ergoss sich mancher schreckhaft verschütteter Tee auf die blütenweisse Sommergarderobe, die man damals im Königreich Bayern zu tragen pflegte. Überhaupt sind schiessende Gatten gepflegten Gesprächen über Untreue nicht wirklich zuträglich, und aus diesem Missverhältnis heraus entstand eine Idee, die später die Geschicke der Oberschicht der Stadt auf Jahrhunderte bestimmen sollte.
Die Damen der Gesellschaft wollten nämlich eine Trennung von ihren schiessenden Herren. Möglicherweise wollten auch die schiessenden Herren eine Trennung von den oidn Tratschn, ich kenne leider nur die von weiblicher Seite überlieferte Tradition, die auf meine Grosstante und meine Grossmutter zurückgeht, die beide noch den Prinzregenten Luitpold gesehen haben. Um diese räumliche Trennung zu vollziehen, ohne eine gewisse familiäre Nähe ganz aufzugeben, verfiel man nun auf die Idee, sich entlang des Weges zum Schiessplatz, dem daher sogenannten Probierlweg, grössere Grundstücke zu kaufen. Die wurden dann gerodet, mit Apfel- und Zwetschgenbäumen bepflanzt, mit Beeten für Gemüse und Blumen versehen, und dann baute man noch eine Hütte, in der man die wichtigsten Dinge zum Gebrauch am Wochenende unterbrachte.
Dort, in diesen Gärten, spielte sich dann im Sommer das gesellschaftliche Leben ab. Die meisten alteingesessenen Familien hatten so einen Garten für die Sommerfrische, denn bis zur Pauschalreise dauerte es für die meisten bis in die 50er Jahre. Die Leistung meines Grossvaters, mit seinem ersten Tourenwagen 1928 nach Italien zu fahren und mit dem Zug und einer wichtigen Erfahrung zum Thema Lenkverhalten in Kurven heimzukehren, galt damals noch als grosses Abenteuer. Wenn überhaupt, kam man in die Voralpen zu der Verwandtschaft in Rosenheim, mit dem Zug zur ferneren Verwandtschaft zu den Schlawacken in Wien und Budapest, aber meistens war man hier in den Lauben vor der Stadt. Genau so kenne ich das noch aus meinen jungen Jahren, als die Stadt nur halb so viele Einwohner hatte. Die alten Familien aber überlegten damals, ob das Verbleiben in der Altstadt noch zeitgemäss war. Schliesslich wohnten alle anderen draussen in modernen Blocks und Bungalos, in denen sich die zugezogene Funktionselite nieder gelassen hatte. Die alten Häuser in der Stadt waren nicht mehr repräsentativ genug. Man wollte raus ins Grüne.
Und so kam, was naheliegend war. Die Hütten, Beete und Bäume am Probierlweg verschwanden, und statt dessen errichtete sich hier die bessere Gesellschaft ihre Villen. Man hatte das Grundstück, den Schiessplatz gab es nach 1945 nicht mehr, keiner brauchte mehr Äpfel und Zwetschgen, die man im Supermarkt weitaus schöner und ohne Wurm bekam, und auch das Grundstück meines Clans wurde von der Villa meiner Grosstante überbaut. Hier blieben die Apfelbäume jedoch stehen, die bis heute die Grundlage des heimischen Apfelstrudels sind, der alte Brunnen wurde weiter betrieben, aber die alte Laube, ein dunkelblau gestrichenes Holzhaus mit vier Fenstern und einer Tür, wurde wegen Baufällugkeit abgerissen. Erhalten hat sich davon nur eine Blumenkiste mit tanzenden Amoretti - und mein heutiger Küchenschrank.
Wäre er aus Nuss oder Mahagoni gewesen, hätte keiner "den dunklen Hund" mit seinen historistischen Schnörkeln und Säulen haben wollen. Was ihn gerettet hat, ist sein Material: Billige Kiefer mit Astlöchern. Nicht das Beste, zur Zeit seiner Entstehung eigentlich nicht dem Stand angemessen, aber es war nur ein Möbel für die Sommerlaube, also war man damit zufrieden. Kiefer natur wiederum war schlechthin das Material der ersten Ikea-Generation Ende der 60er Jahre, zu der auch meine Eltern gehörten. Kiefer von Ikea war der letzte Schrei und ihr Bekenntnis zur neuen Zeit. Die Form des Küchenschranks fanden sie grauenvoll, aber in einem Anfall von antiautoritärer Behauptung gegen die Nierentische oder die stromlinienförmigen, skandinavischen Möbelsitten der vorhergehenden Generation nahm meine Mutter den Küchenschrank und postierte ihn in der oberen Küche der Einliegerwohnung, von der man annahm, dass eines der Kinder sie später bewohnen würde.
Meine Mutter jedenfalls beschloss, den Schrank zeitgemäss zu machen. Und deshalb die grauenvoll kitschige weissblaue Borte zu entfernen. Sie löste die Nägel, und warf sie in die Aschentonne. Tags darauf kam meine Grossmutter zufällig auf den Schrank zu sprechen und erzählte die Geschichte dieser Borte: Als der Kronprinz eines Sommers für eine Militätparade die Stadt besuchte, verfielen alle in einen weissblauen patriotischen Freudentaumel, und draussen in den Lauben stickten und nähten die Frauen über Wochen hinweg weissblaue Fahnen, Wimpel, Bordüren und Borten. Wo immer man konnte, brachte man die Landesfarben an, und so eben auch die feinste Stickerei am Küchenschrank, den meine Mutter jetzt hatte, ein besonderes Relikt einer besonderen Zeit, in der alle hofften, der Kronprinz wollte seinen huldvollen Blick auf all die geschmückten Lauben werfen. Schneller ist meine Mutter danach wohl nie mit ihrem signalgrünenAudi-100- Schlachtschiff nach Hause gerast, um die Borte aus der Mülltonne zu retten und dort anzubringen, wo sie jetzt wieder ist.
Sie ist unglaublich fein gestickt, Knoten für Knoten, sie ist inzwischen fast 100 Jahre alt und immer noch wie neu, eine Qualität, die nur entsteht, wenn jemand sich wirklich alle Mühe gibt, das Ergebnis vieler Sonntag Nachmittage draussen vor der Stadt, und deshalb das Einzige in diesem Schrank, woran in wirklich hänge.
Und wenn ich jetzt alles hergeben müsste und nur eine Sache da drin behalten dürfte, unter all den in Kälte, Eis und Hitze den Händlern entrissenen Schätzen, den englichen Teekannen, den Biedermeierschalen, den amerikanischen Streuern, den weniger wertvollen, versilberten Tabletts, die zur Hochzeit verschenkt wurden und den Gläsern der Witwe Loetz -

dann würde ich das alles hergeben und lediglich die weissblaue Borte behalten. Denn mit der hat es, wie überhaupt dem Küchenschrank, eine besondere Bewandtnis.
Früher war es in dieser Stadt so, dass man innerhalb der Stadtmauern wohnte. Wer hier zu den besseren Kreisen gehörte, war meist auch Mitglied eines der Schützenvereine, oder, wenn es die rund 1000 Personen umfassenden Clans der Oberschicht betraf, Mitglied im Jagdverein. Darunter kamen dann, für die Bewohner der schlechteren Viertel, die Reservistenvereine. Aber die meisten Männer hatten zuhause irgendeinen Schiessprügel. Der verlangte nach Aufmerksamkeit und Übung. Und dafür gab es in den Donauaauen einen Schiessplatz, wo man sich am Samstag und Sonntag zum Ballern traf.
Der Schiessplatz wiederum lag in der sumpfigen, unfruchtbaren Donauniederung westlich der Altstadt, jenseits der Stadtbefestigung. Man baute eine schnurgerade Strasse hinaus, dazu noch ein Schützenhäuschen, später eine Gaststätte, und dort war dann stets geselliges Treiben: Die Männer schossen, die Kinder spielten, und die Frauen tratschten, wer mit wem im Bett war und welches Kind ein Bastard sein möge. Immer wieder unterbrochen durch den lauten Knall der Büchsen und Jagdflinten.
Damals waren die Damen auch noch etwas empfindsamer als ihre heutigen Nachfahrinnen, die von der Glotze ganz andere Ballereien beim Chipsfressen gewöhnt sind, und so ergoss sich mancher schreckhaft verschütteter Tee auf die blütenweisse Sommergarderobe, die man damals im Königreich Bayern zu tragen pflegte. Überhaupt sind schiessende Gatten gepflegten Gesprächen über Untreue nicht wirklich zuträglich, und aus diesem Missverhältnis heraus entstand eine Idee, die später die Geschicke der Oberschicht der Stadt auf Jahrhunderte bestimmen sollte.
Die Damen der Gesellschaft wollten nämlich eine Trennung von ihren schiessenden Herren. Möglicherweise wollten auch die schiessenden Herren eine Trennung von den oidn Tratschn, ich kenne leider nur die von weiblicher Seite überlieferte Tradition, die auf meine Grosstante und meine Grossmutter zurückgeht, die beide noch den Prinzregenten Luitpold gesehen haben. Um diese räumliche Trennung zu vollziehen, ohne eine gewisse familiäre Nähe ganz aufzugeben, verfiel man nun auf die Idee, sich entlang des Weges zum Schiessplatz, dem daher sogenannten Probierlweg, grössere Grundstücke zu kaufen. Die wurden dann gerodet, mit Apfel- und Zwetschgenbäumen bepflanzt, mit Beeten für Gemüse und Blumen versehen, und dann baute man noch eine Hütte, in der man die wichtigsten Dinge zum Gebrauch am Wochenende unterbrachte.
Dort, in diesen Gärten, spielte sich dann im Sommer das gesellschaftliche Leben ab. Die meisten alteingesessenen Familien hatten so einen Garten für die Sommerfrische, denn bis zur Pauschalreise dauerte es für die meisten bis in die 50er Jahre. Die Leistung meines Grossvaters, mit seinem ersten Tourenwagen 1928 nach Italien zu fahren und mit dem Zug und einer wichtigen Erfahrung zum Thema Lenkverhalten in Kurven heimzukehren, galt damals noch als grosses Abenteuer. Wenn überhaupt, kam man in die Voralpen zu der Verwandtschaft in Rosenheim, mit dem Zug zur ferneren Verwandtschaft zu den Schlawacken in Wien und Budapest, aber meistens war man hier in den Lauben vor der Stadt. Genau so kenne ich das noch aus meinen jungen Jahren, als die Stadt nur halb so viele Einwohner hatte. Die alten Familien aber überlegten damals, ob das Verbleiben in der Altstadt noch zeitgemäss war. Schliesslich wohnten alle anderen draussen in modernen Blocks und Bungalos, in denen sich die zugezogene Funktionselite nieder gelassen hatte. Die alten Häuser in der Stadt waren nicht mehr repräsentativ genug. Man wollte raus ins Grüne.
Und so kam, was naheliegend war. Die Hütten, Beete und Bäume am Probierlweg verschwanden, und statt dessen errichtete sich hier die bessere Gesellschaft ihre Villen. Man hatte das Grundstück, den Schiessplatz gab es nach 1945 nicht mehr, keiner brauchte mehr Äpfel und Zwetschgen, die man im Supermarkt weitaus schöner und ohne Wurm bekam, und auch das Grundstück meines Clans wurde von der Villa meiner Grosstante überbaut. Hier blieben die Apfelbäume jedoch stehen, die bis heute die Grundlage des heimischen Apfelstrudels sind, der alte Brunnen wurde weiter betrieben, aber die alte Laube, ein dunkelblau gestrichenes Holzhaus mit vier Fenstern und einer Tür, wurde wegen Baufällugkeit abgerissen. Erhalten hat sich davon nur eine Blumenkiste mit tanzenden Amoretti - und mein heutiger Küchenschrank.
Wäre er aus Nuss oder Mahagoni gewesen, hätte keiner "den dunklen Hund" mit seinen historistischen Schnörkeln und Säulen haben wollen. Was ihn gerettet hat, ist sein Material: Billige Kiefer mit Astlöchern. Nicht das Beste, zur Zeit seiner Entstehung eigentlich nicht dem Stand angemessen, aber es war nur ein Möbel für die Sommerlaube, also war man damit zufrieden. Kiefer natur wiederum war schlechthin das Material der ersten Ikea-Generation Ende der 60er Jahre, zu der auch meine Eltern gehörten. Kiefer von Ikea war der letzte Schrei und ihr Bekenntnis zur neuen Zeit. Die Form des Küchenschranks fanden sie grauenvoll, aber in einem Anfall von antiautoritärer Behauptung gegen die Nierentische oder die stromlinienförmigen, skandinavischen Möbelsitten der vorhergehenden Generation nahm meine Mutter den Küchenschrank und postierte ihn in der oberen Küche der Einliegerwohnung, von der man annahm, dass eines der Kinder sie später bewohnen würde.
Meine Mutter jedenfalls beschloss, den Schrank zeitgemäss zu machen. Und deshalb die grauenvoll kitschige weissblaue Borte zu entfernen. Sie löste die Nägel, und warf sie in die Aschentonne. Tags darauf kam meine Grossmutter zufällig auf den Schrank zu sprechen und erzählte die Geschichte dieser Borte: Als der Kronprinz eines Sommers für eine Militätparade die Stadt besuchte, verfielen alle in einen weissblauen patriotischen Freudentaumel, und draussen in den Lauben stickten und nähten die Frauen über Wochen hinweg weissblaue Fahnen, Wimpel, Bordüren und Borten. Wo immer man konnte, brachte man die Landesfarben an, und so eben auch die feinste Stickerei am Küchenschrank, den meine Mutter jetzt hatte, ein besonderes Relikt einer besonderen Zeit, in der alle hofften, der Kronprinz wollte seinen huldvollen Blick auf all die geschmückten Lauben werfen. Schneller ist meine Mutter danach wohl nie mit ihrem signalgrünenAudi-100- Schlachtschiff nach Hause gerast, um die Borte aus der Mülltonne zu retten und dort anzubringen, wo sie jetzt wieder ist.
Sie ist unglaublich fein gestickt, Knoten für Knoten, sie ist inzwischen fast 100 Jahre alt und immer noch wie neu, eine Qualität, die nur entsteht, wenn jemand sich wirklich alle Mühe gibt, das Ergebnis vieler Sonntag Nachmittage draussen vor der Stadt, und deshalb das Einzige in diesem Schrank, woran in wirklich hänge.
donalphons, 15:05h
Donnerstag, 1. März 2007, 15:05, von donalphons |
|comment
abulafia,
Donnerstag, 1. März 2007, 16:36
Schöne Geschichte, danke!
... link
donalphons,
Donnerstag, 1. März 2007, 16:42
Bitte. Die lag mehr oder weniger ein Jahr in meinem Kopf, heute hatte ich endlich mal Zeit :-)
... link
... comment
logog,
Donnerstag, 1. März 2007, 17:30
Danke, mal wieder! War der Küchenschrank immer natur? Ich kenne die fast nur als weisslackierte und Anfang der 80er wieder abgebeizte Stücke.
... link
donalphons,
Donnerstag, 1. März 2007, 17:32
Zwischenzeitlich war er mal blau gefasst und davor mit Bierfarbe gestrichen.
... link
logog,
Donnerstag, 1. März 2007, 18:09
In meiner Jugend war ich auch mal ziemlich blau und der Situation entsprechend relativ gefasst, als meine Oma mich morgens um 5 auf der Kellertreppe zur Rede stellte. Es lag irgendwie am Bier. Ich krieg das nur mit der Farbe nicht unter.
Ist das eine in Bayern übliche Art, die Möbel gegen Fliegen, Ottern und Nachbarshund zu imprägnieren? Kippt ihr da wirklich massweis Bier drüber? Oder war der Anstrich vom Farbton bierfarben?
Ist das eine in Bayern übliche Art, die Möbel gegen Fliegen, Ottern und Nachbarshund zu imprägnieren? Kippt ihr da wirklich massweis Bier drüber? Oder war der Anstrich vom Farbton bierfarben?
... link
donalphons,
Donnerstag, 1. März 2007, 18:55
Bierfarbe ist eine Mischung aus Bier und Pigmenten - im Prinzip ist Bier sowohl Verflüssiger als auch Lösungsmittel. Das war früher sehr beliebt, man konnte damit Furnier imitieren, oder sogar Marmor.
... link
... comment
lexx,
Donnerstag, 1. März 2007, 19:04
Schöne Geschichte... und schöne Borte
Meine Bewunderung für die Handarbeitskünste der Großmutter
Meine Bewunderung für die Handarbeitskünste der Großmutter
... link
donalphons,
Donnerstag, 1. März 2007, 19:09
Ururgrossmutter - meine Oma hatte damals ganz andere Sachen im Kopf :-)
... link
first_dr.dean,
Donnerstag, 1. März 2007, 19:18
Danke!
Nach den ersten drei Halbsätzen dachte ich erst, dass ich für diesen Text zu müde bin, zu müde vom Tageswerk, um ihn zuende zu lesen. Dann, am Ende des ersten Drittels, fing der Text an zu fesseln, und zum Schluss entstand bei mir ein Gefühl von Dankbarkeit, - wie für eine etwas zu dick oder umständlich eingepackte Praline, an die man nach dem Verspeisen mit großen Wohlbehagen zurückdenkt.
... link
... comment
pathologe,
Freitag, 2. März 2007, 08:30
Ein schöner Text
Erinnert mich irgendwie an einen Beitrag zum bis dato unbepreisten "Meine Provinz"-Wettbewerb.
;-)
;-)
... link
stilhaeschen,
Freitag, 2. März 2007, 16:59
Allerdings. Feiner Text zur feinen Borte.
Heute auf der Autobahn eine Kolonne Polizeibusse gesehen, von denen einige tatsächlich riesige Bayernflaggen ins Heckfenster drapiert hatten. Hammer scho wieda Königsbesuch, ging da was an mir vorbei?
Heute auf der Autobahn eine Kolonne Polizeibusse gesehen, von denen einige tatsächlich riesige Bayernflaggen ins Heckfenster drapiert hatten. Hammer scho wieda Königsbesuch, ging da was an mir vorbei?
... link
first_dr.dean,
Freitag, 2. März 2007, 22:34
Nee, das war vermutlich nur die Exkorte für Acker ("Ackermann") auf seinem Weg zur Münchner B*LD-Lokalredaktion. Ähm, nehme ich an.
... link
... comment